Spurensuche: Der Paraklet früher und heute
Überlegungen zur Topographie und Architektur des ehemaligen Paraklet-Klosters bei Nogent-sur-Seine, © Dr. Werner Robl, März 2000, Überarbeitung September 2001
 |
Ach, wie die von Hirten verlassene Herde hat man sie vertrieben vom heiligen Hort. Ich lausche vergebens, die hohen Gewölbe hallen nicht mehr vom Gesang trauriger Choräle. Alles schweigt. Da höre ich den donnernden Hieb der gottlosen Hacke, die im geschändeten Schiff die frommen Bilder der heiligen Väter zerschlägt. Ich höre die emsigen Schläge zerstörender Hämmer, die Schläge gemeiner Gesellen, die verblendete Menge, sie lästert den Namen des Herrn am heiligen Ort. Oh, haltet ein, hört auf, Ihr Unglücklichen, hier ist meine Zuflucht, hierher richte ich mein Gebet. Nehmt sie mir nicht. Zu sehr habe ich das Leben gekostet; nie mehr werde ich den bitteren Kelch der Trauer bis zur Neige leeren. Entsetzt sehe ich, was ich fliehe. Alphonse de Lamartine, 1808 |
Einleitung
 Wer heute die karge Kreidelandschaft der trockenen Champagne durchfährt und Hauptverkehrstraßen meidet, stößt vielleicht - weitab von größeren touristischen Sehenswürdigkeiten - zwischen Troyes und Nogent-sur-Seine in relativ unspektakulärer Umgebung auf ein Landgut am Ufer des träge dahinfliessenden Flüsschens Ardusson - mit einem durch Türme befestigten Bauernhof, einem Gutshaus, einer Mühle. Eine Szenerie, wie sie sich im traditionsbewussten Frankreich an unzähligen Stellen wiederholt. Das Straßenschild Le Paraclet gibt dem eilig Reisenden keinen Grund, hier anzuhalten. Dies war noch vor einhundert Jahren ganz anders: Unzählige Besucher fanden den Weg hierher; z. T. waren sie weit gereist. Hier stand bis zur französischen Revolution das Kloster mit dem eigenartigen Namen Paraklet, d.h. Tröster. Es war das Lebenswerk von Abaelard, dem ebenso berühmten wie umstrittenen Frühscholastiker aus dem 12. Jahrhundert, und Heloïsa, seiner Frau. Der Paraklet ist nichts für Eilige. Sicher gab und gibt es in Frankreich kunstgeschichtlich und kulturhistorisch bedeutendere Klöster. Weder die Großartigkeit eines Klosters wie Fontenay oder Senanque noch die Größe und Bedeutung von Cluny oder Cîteaux ist hier zu erwarten. Wer mit Gewinn den Paraklet besuchen will, sollte sich vorbereitet haben.
Wer heute die karge Kreidelandschaft der trockenen Champagne durchfährt und Hauptverkehrstraßen meidet, stößt vielleicht - weitab von größeren touristischen Sehenswürdigkeiten - zwischen Troyes und Nogent-sur-Seine in relativ unspektakulärer Umgebung auf ein Landgut am Ufer des träge dahinfliessenden Flüsschens Ardusson - mit einem durch Türme befestigten Bauernhof, einem Gutshaus, einer Mühle. Eine Szenerie, wie sie sich im traditionsbewussten Frankreich an unzähligen Stellen wiederholt. Das Straßenschild Le Paraclet gibt dem eilig Reisenden keinen Grund, hier anzuhalten. Dies war noch vor einhundert Jahren ganz anders: Unzählige Besucher fanden den Weg hierher; z. T. waren sie weit gereist. Hier stand bis zur französischen Revolution das Kloster mit dem eigenartigen Namen Paraklet, d.h. Tröster. Es war das Lebenswerk von Abaelard, dem ebenso berühmten wie umstrittenen Frühscholastiker aus dem 12. Jahrhundert, und Heloïsa, seiner Frau. Der Paraklet ist nichts für Eilige. Sicher gab und gibt es in Frankreich kunstgeschichtlich und kulturhistorisch bedeutendere Klöster. Weder die Großartigkeit eines Klosters wie Fontenay oder Senanque noch die Größe und Bedeutung von Cluny oder Cîteaux ist hier zu erwarten. Wer mit Gewinn den Paraklet besuchen will, sollte sich vorbereitet haben.Der Paraclet ist ein spiritueller Raum: Gemeinschaftswerk Heloïsas und Abaelards, steingewordene Utopie eines Doppelklosters, Zeugnis der gegenseitigen Hinwendung und Treue, Symbol der geistigen und religiösen Auseinandersetzung des 12. Jahrhunderts. Hier wurde erstmalig in freier Lehre - dogmatisch ungebunden - dem credo ut intellegam eines Anselm von Canterbury das intellego ut credam eines Abaelard entgegengesetzt. Hier entstand aus einer Not heraus die erste, wirklich frei zu nennende Universität Europas - als campus im eigentlichen Sinn des Wortes. Zahlreiche Werke, die später die Scholastik beeinflussen sollten, wurden hier geschrieben oder redigiert. Dennoch war dies alles nur eine flüchtige Episode - mehr nicht, denn für eine wirkliche Renaissance war die Zeit noch nicht reif. Später wurde der Paraklet - erneut aus einer Not heraus - zum Gründungsort für einen Nonnenkonvent. Gemeinsam mit Heloïsa entwickelte Abaelard den theoretischen Unterbau zu diesem Unternehmen: eine Gott und den Menschen gleichermaßen zugewandte Theologie - eine Theologie, die die personale Gewissensentscheidung über eine menschenfeindliche Dogmatik stellte - eine Theologie, die erstmals auch für Frauen lebbar sein sollte - eine Theologie der Toleranz gegenüber Andersdenkenden - eine Theologie, die Schrifttreue, Bewahrung der Tradition und Vernunftorientierung miteinander verband. Für diesen Konvent schrieb Abaelard eine große Sammlung von Predigten und Hymnen. Hier entstanden auch feinsinnige und herzbewegende Briefe Heloïsas - Teile des später so berühmten Schriftwechsels, seltene Exemplare mittelalterlicher Briefkunst, in denen das Paar gegenseitige psychologische Führung und seelische Hilfe mit ausgefeilter Formulierungskunst verband. Was die Gotik für die Baukunst, das bedeutet Stil und Inhalt dieser Werke für die Literatur. Hier gelang schließlich Heloïsa das, was Abaelard zu seiner Zeit nicht gelungen war, nämlich die Gründung eines stabilen, bald erstaunlich expandierenden Klosterverbandes. Hier wurden schließlich beide - ihrem Wunsch entsprechend - begraben. Auch nach dem Tode Abaelards und Heloïsas zeigte das Kloster über 6 Jahrhunderte eine erstaunliche Vitalität und Stabilität. Erst während der französischen Revolution ereilte es dasselbe traurige Schicksal wie viele andere bekannte Klöster Frankreichs: Es wurde bis auf wenige Überreste zerstört.
Wer sich also diesem Ort - ob reell oder in Gedanken - nähern will, sollte vorbereitet sein und er sollte Freude daran haben, nach Spuren zu suchen, Schlüsse zu ziehen und auch ein wenig die Fantasie spielen lassen. Nur wenig ist heute noch von der einstigen Klosteranlage vorhanden. Wie es scheint, hat sich die Forschung bisher kaum mit diesem Monument beschäftigt - sei es, weil die Auswertung der Handschriften lohnendere Ergebnisse versprach oder sei es, weil man aufgrund der Quellen annehmen durfte, dass die Spurensuche in dieser ehemaligen Klosteranlage kaum mehr überraschende Resultate zeitigen würde. Trotzdem ist es - wie noch zu zeigen ist - durchaus reizvoll und interessant, Kenntnisse der Quellen- resp. Urkundenforschung durch Vergleiche mit der einstigen und heutigen Topographie des Klosters auf deren Evidenz und Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen. Viele der Wirkungsstätten Abaelards und Heloïsas sind dafür nicht geeignet, denn sie sind durch massive urbane Bebauung verschwunden oder soweit verändert und zerstört, dass eine Erforschung nicht mehr möglich ist. Dies gilt jedoch nicht für die Überreste des Paraklet-Klosters. Sie liegen auch heute noch relativ einsam, in dieser ländlichen Umgebung der trockenen Champagne, fern von größeren Siedlungen. Das Areal befindet sich seit der französischen Revolution in Privatbesitz. Der Gutshof wird noch bewirtschaftet. Größere Umbauten haben zuletzt nicht mehr stattgefunden. Allerdings bemühen sich die heutigen Besitzer um den Erhalt der verbliebenen historischen Substanz. Bei Kurzbesuchen in den Jahren 1998 und 2001 hinterließ das Paraklet-Areal einen etwas melancholischen Eindruck. Gutshaus und Park wirkten still und verträumt, strahlten jedoch eine eigenartig anrührende Atmosphäre aus.
Das Terrain und die Wege
...sie (Seneschall Stephan von Garlande und Abt Suger von St. Denis als Verhandlungspartner) haben mir erlaubt, in eine Einöde meiner Wahl überzusiedeln, wenn ich mich nur keiner anderen Abtei unterwarf, und das fand in Gegenwart des Königs Zustimmung und Bekräftigung von beiden Seiten.
Abaelard, Historia Calamitatum
Dass bei diesen Verhandlungen bereits von einem Verbleiben Abaelards in der Champagne die Rede war, ist anzunehmen. Deshalb wird auch das Grafenhaus der Champagne in die Verhandlungen eingeschaltet gewesen sein - wahrscheinlich Graf Theobald der Große selbst oder zumindest einer oder mehrerer seiner Großvasallen, auf jeden Fall aber Milo, der Grundherr von Nogent, der seine Aftervasallen mit dem Ardusson-Tal belehnt hatte. Denn Abaelard hatte einen Ort in diesem Tal zur Errichtung der Einsiedelei bereits seit längerer Zeit planvoll ins Auge gefasst:
So begab ich mich also in eine Einöde im Gebiet von Troyes, die mir schon von früher her bekannt war.
Abaelard, Historia Calamitatum
Wenn man die Aussagen der Historia Calamitatum genau bedenkt, wird man unterstellen dürfen, dass Abaelard nicht das lebenslange Schicksal eines Klausners anvisiert hatte. Dazu hätte es kaum Verhandlungen unter Einschaltung des Königs bedurft. Vielmehr dürfte er - aus der Eremitenbewegung heraus - die Neugründung eines Konventes ins Auge gefasst haben, in dem er ungestört seinen geistigen Führungsanspruch verwirklichen konnte. Da er diesen Anspruch in Saint-Denis nicht hatte verwirklichen können, nahm er das risikoreiche Unternehmen einer Neugründung in Angriff. Abaelard handelte damit keineswegs nicht innovativ, sondern er folgte durchaus probaten Vorbildern: Erst ein Jahr vor ihm hatte Norbert von Xanten seinen Orden in Prémontré etabliert, kaum 100 Meilen vom Paraklet entfernt. Auch die zisterziensischen Abteien mögen Abaelard als Vorbild gedient haben. Man denke nur an die bereits erfolgten und erfolgreichen Klostergründungen seines späteren Rivalen Bernhard, wie Fontenay oder Clairvaux. Im betreffenden Gebiet der Champagne selbst - zwischen Troyes und Provins - waren so zur damaligen Zeit in einem Zeitraum von circa zwanzig Jahren in den zur Verfügung stehenden Flusstälern des Ardusson, des Orvin, der Oreuse und des Alain insgesamt 4 Konvente gegründet worden: neben dem Paraklet selbst auch das Priorat von Traînel, das Kloster La Pommeraie - beide zum Paraklet gehörig - und die Zisterzienserneugründung Vauluisant. Diese Gebiet war damals - im Gegensatz zu den Gebieten nördlich der Seine - relativ dünn besiedelt und bestand überwiegend aus flachhügeligem Brachland bzw. Buschwald - boscum -, nur unterbrochen von kleineren Rodungsflächen und einigen Dörfern und Weilern. Nördlich der Seine war dagegen die Besiedelung dichter. Hier waren bereits wesentlich früher mehrere Konvente gegründet worden, z.B. Nesle-la-Reposte, Andecy oder Sézanne. Abaelards Gründung muss so als Teil eines größeren geopolitischen Konzeptes der Champagne aufgefasst werden, als Ausdruck der Infrastrukturpolitik des Grafenhauses selbst.
Abaelard hatte sich für das Paraklet-Areal aus reiflicher Überlegung heraus entschieden und das Areal durch Schenkung erworben. Aus der von ihm auch von anderer Stelle her bekannten Diskretion heraus nannte er die großzügigen Gönner leider nicht:
...nachdem mir von einigen Leuten Land geschenkt worden war...
Abaelard, Historia Calamitatum
Der Gründungsort des Parakleten muss aufgrund seiner Eigenschaften für den benötigten Zweck als nahezu perfekt ausgesucht betrachtet werden:
- Abseits in einer Einöde gelegen, aber doch nahe genug an den aufstrebenden Märkten der Champagne - Troyes, Provins, Nogent - mit den dazugehörigen Verbindungsstraßen.
- Soweit flussaufwärts am Ardusson, dass einerseits das Wasser rein und trinkbar war, andererseits die Wasserschüttung den für einen Konvent unabdingbaren Mühlbetrieb ermöglichte.
- In einem Auwald, der reichlich Bauholz für die zur errichtenden Gebäude zur Verfügung stellte.
- Im Bereich von Talflanken, die den Abbau von Bausteinen sowie die Beschaffung von Kalk für die Zementproduktion möglich machten.
- In einem Terrain, das gleichermaßen die Möglichkeit für Weide-, Getreide-, Forstwirtschaft, Fischzucht und Jagd, ja sogar Weinbau bot.
Auch alle anderen, oben genannten Neugründungen verfügten über nahezu identische Geländebedingungen, wie auch noch heute - lange nach ihrer Zerstörung - bei einem Besuch nachvollzogen werden kann.
Schon seit alter Zeit war das Ardusson-Tal Siedlungsland. Wie ist Abaelards eigene Aussage zu werten, es habe sich beim Paraklet-Areal um einen wilden, entlegenen, letztlich menschenleeren und gefährlichen Landstrich gehandelt? Hatte er maßlos übertrieben?In dieser Einsamkeit mit einem befreundeten Kleriker im Verborgenen lebend, konnte ich allen Ernstes dem Herrn das Lied singen: "Siehe, ich habe mich ferne weggemacht und bin in der Wüste geblieben" (Psalm 55, 8).
Abaelard, Historia Calamitatum
Wildnis war ringsumher, nur wilden Tieren oder Räubern zugänglich; sie kannte keine menschliche Wohnung, sie bot keine Behausung. Unter den Lagerstätten des Wildes, bei den Höhlen der Räuber, wo man Gott nicht einmal zu nennen pflegt, hast du das göttliche Tabernakel aufgerichtet und einen Tempel dem Heiligen Geist geweiht.
Heloïsa, Brief 2 an Abaelard
Die Geschwindigkeit, mit der die Studenten zu diesem angeblich entlegenen Platz geströmt waren, kann vielleicht durch seine Nähe zu Nogent-sur-Seine und die Handelsrouten der Champagne erklärt werden.
Michael Clanchy, Abelard, A Medieval Life, 1997
Rechts des Weges von Saint-Aubin nach Longue-Perthe findet sich ein Cromlech, bekannt unter dem Namen Altarsteine... ein Menhir mit Namen "Grande Pierre", im Norden des Dorfes am rechten Ufer des Ardusson... Römerstrassen mit Namen "Chemin-d'Orléans, Chemin-de-Sens"... oberhalb La Chapelle-Godefroy, im Osten dieses Weilers, am Ort mit dem Namen "Haut-de-la-Gloriette" einen antiken Friedhof... schließlich die Pfarrkirche von Saint-Aubin aus dem 12. Jahrhundert.
Arbois de Jubainville, Répertoire archéologique du Département de l'Aube Paris, 1861
Bis zum Jahre 1978 beschrieb die Departementstraße 442 Nogent-Troyes eine Kurve, die am Äbtissinnenhaus vorüberzog und einen direkten Zutritt durch das vergitterte Tor zur Hauptallee zuließ. Die Straßenbegradigung zwingt jetzt die Besucher, entweder das Innere des Landsitzes durch die Einfahrt des Bauernhofes zu betreten oder die Gebäude zu umrunden, um den Haupteingang durch den dem Verkehr noch zugänglichen Seitenweg zu erreichen.
Albert Willocx, Abélard, Heloïse et le Paraclet, 1996
Ein Blick zurück: André Duchesne zitiert in seiner Erstedition von Abaelards Werk aus dem Jahre 1616 Francesco Petrarca, der schon im 14. Jahrhundert nachweislich ein Manuskript des berühmten Briefwechsels von Abaelard und Heloïse besaß (PL Band 178, Seite 159):
Dieser Peter Abaelard war aus Furcht vor Missgunst in entlegene Gebiete des Ödlandes von Troyes eingedrungen.
Petrarca, Buch 2 über das Einsiedlerleben
Es lohnt es sich, mittels alter Karten und einer Luftbildaufnahme des Institut Géographique National aus dem Jahre 1998 der Sache auf den Grund zu gehen.
 Wenn man die aktuelle topographische Karte der Region betrachtet, erkennt man, dass alle Dörfer zwischen Nogent und Troyes dem Typus eines mittelalterlichen Straßen- oder Reihendorfes entsprechen. Dabei liegt nur Saint-Aubin - wie der flussaufwärts gelegene Paraklet - am linken Ufer des Ardusson, die weiteren Dörfer in Richtung Troyes - z.B. Quincey, Saint-Loup, Saint-Martin de Bossenay - am rechten Ufer des Ardusson. Letztere Dörfer liegen heute nicht mehr an der Departementstraße 442, die südlich des Ardusson verläuft. Es liegt der Schluss nahe, dass die frühmittelalterliche Trasse nördlich des Ardusson lag und diese Dörfer verband. Wenn andererseits die Annahme stimmt, dass diese Trasse auch Saint-Aubin passierte, dann muss die Straße den Ardusson westlich des Paraklet überquert haben und nach Norden abgebogen sein.
Wenn man die aktuelle topographische Karte der Region betrachtet, erkennt man, dass alle Dörfer zwischen Nogent und Troyes dem Typus eines mittelalterlichen Straßen- oder Reihendorfes entsprechen. Dabei liegt nur Saint-Aubin - wie der flussaufwärts gelegene Paraklet - am linken Ufer des Ardusson, die weiteren Dörfer in Richtung Troyes - z.B. Quincey, Saint-Loup, Saint-Martin de Bossenay - am rechten Ufer des Ardusson. Letztere Dörfer liegen heute nicht mehr an der Departementstraße 442, die südlich des Ardusson verläuft. Es liegt der Schluss nahe, dass die frühmittelalterliche Trasse nördlich des Ardusson lag und diese Dörfer verband. Wenn andererseits die Annahme stimmt, dass diese Trasse auch Saint-Aubin passierte, dann muss die Straße den Ardusson westlich des Paraklet überquert haben und nach Norden abgebogen sein.
 Alte Landkarten bestätigen diese Vermutung:
Alte Landkarten bestätigen diese Vermutung:
Ein Atlas der Region von 1780 (Carte topographique d'Allemagne, Blatt 55, Kupferstich von G. Abel nach J.G. Jaennike bei W. Jäger, 1780) bestätigt eine nördlich des Ardusson gelegene Direktverbindung nach Troyes (Bild rechts).
 Ein Katasterplan des Paraklet von 1708 (abgebildet in Roserot, Dictionnaire historique de la champagne meridionale, 1790) zeigt die weit nördlich des Paraklet auf der Anhöhe verlaufende Strasse mit der Bezeichnung: ancien grand chemin de Troyes (siehe Bild links).
Ein Katasterplan des Paraklet von 1708 (abgebildet in Roserot, Dictionnaire historique de la champagne meridionale, 1790) zeigt die weit nördlich des Paraklet auf der Anhöhe verlaufende Strasse mit der Bezeichnung: ancien grand chemin de Troyes (siehe Bild links).
Dabei existierten zwei Trassen nördlich des Ardusson: Eine verband die Ortschaften direkt, eine zweite verlief noch weiter nördlich unter Umgehung derselben. Die Altstraßenforschung kann in ganz Europa derartige Höhenwege als mittelalterliche Hauptverbindungsstraßen nachweisen. In den feuchten Jahreszeiten gab es für großrädrige Pferde- oder Ochsenfuhrwerke in einem Talgrund kaum ein Durchkommen.
 Der einstige Straßenverlauf ist auf folgender Luftaufnahme noch an Feldmarken zu erkennen:
Der einstige Straßenverlauf ist auf folgender Luftaufnahme noch an Feldmarken zu erkennen:
Man erkennt das heute verschwundene Straßenstück nach dem Ardusson-Übergang an der Bergflanke aufgrund von Feldverfärbungen (Pfeile nach oben), wahrscheinlich gesäumt von verschwundenen Rundgebäuden entlang der Strecke (Pfeile nach rechts), vermutlich mittelalterlichen Windmühlen. Allerdings ist bei rechter Struktur nicht ganz auszuschließen, dass sie auch erst durch das Bombardement während des Zweiten Weltkrieges entstanden ist.
Der Nachweis ist jedoch erbracht: Auch wenn das Paraklet-Areal von Dörfern und Nutzland umgeben war, so lag es in seinen frühen Jahren weder an der vielbegangenen Hauptroute zwischen Troyes oder Nogent, die der Seine folgte, noch an der mittelalterlichen Altstrasse, sondern - ähnlich, wie von Abaelard und Heloïse postuliert - in relativer Einsamkeit am linken Ufer des Paraklet, in einer unverfälschten Auenlandschaft, von dichtem Buschwald umgeben, in dem u. U. durchaus auch wilde Tiere wie Bären oder Wölfe anzutreffen waren. Auch nach der Klostergründung war der Paraklet zunächst nicht an das Durchgangsstraßennetz angebunden und nur durch einen Stichweg von Saint-Aubin aus zu erreichen. In einer Urkunde von 1146 ist ein weiterer Weg aus Richtung Süden, von Charmoy aus, erwähnt:
Das Land von Charma bis zur Mühle, unterhalb des weges, auf dem man zum Paraklet kommt...
Urkunde von 1146 (aus: Abbé Lalore, Cartulaire de l'abbaye du Paraclet, Paris, 1878)
 Allerdings war die Entfernung zur nördlichen Höhenstrasse nicht weit. An sie wurde der Paraklet später durch eine Furt oder Brücke über den Ardusson direkter angebunden. Für schwere Transporte oder Ochsengespanne war dieser Weg wegen des sumpfigen Terrains sicher nicht geeignet. Weiterhin bildete sich ein kleiner Verbindungsweg von Saint-Aubin zum Paraklet und zu einer links des Ardusson gelegenen Straßensiedlung, die heute mit Quincey durch eine Brücke verbunden ist. Brücken und
Wege sind auf der ältesten bekannten Darstellung des Paraklet, einer Federzeichnung von 1548 (Archives
de l'Aube, abgebildet in Roserot, Dictionnaire historique de la champagne meridionale, 1790) abgebildet, wenn auch mit großen Ungenauigkeiten (siehe Zeichnung links).
Allerdings war die Entfernung zur nördlichen Höhenstrasse nicht weit. An sie wurde der Paraklet später durch eine Furt oder Brücke über den Ardusson direkter angebunden. Für schwere Transporte oder Ochsengespanne war dieser Weg wegen des sumpfigen Terrains sicher nicht geeignet. Weiterhin bildete sich ein kleiner Verbindungsweg von Saint-Aubin zum Paraklet und zu einer links des Ardusson gelegenen Straßensiedlung, die heute mit Quincey durch eine Brücke verbunden ist. Brücken und
Wege sind auf der ältesten bekannten Darstellung des Paraklet, einer Federzeichnung von 1548 (Archives
de l'Aube, abgebildet in Roserot, Dictionnaire historique de la champagne meridionale, 1790) abgebildet, wenn auch mit großen Ungenauigkeiten (siehe Zeichnung links).
 Nach und nach siedelten - wohl in Verlauf der Religionskriege - auch einige Bauern in unmittelbarer Nähe des Paraklet, z. T.
auch auf den südlichen Höhen, wie auf einem alten Kupferstich des Paraklet (siehe weiter unten)
dargestellt ist. Ob diese Siedlungsstellen den auf nebenstehender Satellitenaufnahme erkennbaren Bodenmarken entsprechen, ist jedoch ungewiss. Vermutlich handelt es sich dabei um die Spuren des schweren Bombardements
während des Zweiten Weltkrieges, welches den Paraklet nur knapp verschonte und entlang der Strasse und des Ardusson zahlreiche, heute verfüllte Bombentrichter hinterließ. Die etwas weiter südwestlich des Paraklet auf den lehmigen Anhöhen zu erkennende runde Bodenmarke entspricht eventuell einer vormaligen Windmühle (siehe Bild rechts).
Nach und nach siedelten - wohl in Verlauf der Religionskriege - auch einige Bauern in unmittelbarer Nähe des Paraklet, z. T.
auch auf den südlichen Höhen, wie auf einem alten Kupferstich des Paraklet (siehe weiter unten)
dargestellt ist. Ob diese Siedlungsstellen den auf nebenstehender Satellitenaufnahme erkennbaren Bodenmarken entsprechen, ist jedoch ungewiss. Vermutlich handelt es sich dabei um die Spuren des schweren Bombardements
während des Zweiten Weltkrieges, welches den Paraklet nur knapp verschonte und entlang der Strasse und des Ardusson zahlreiche, heute verfüllte Bombentrichter hinterließ. Die etwas weiter südwestlich des Paraklet auf den lehmigen Anhöhen zu erkennende runde Bodenmarke entspricht eventuell einer vormaligen Windmühle (siehe Bild rechts).
Noch vor 1700 wurde südlich des Ardusson der Vorläufer der heutigen Departementstrasse gebaut und der Paraklet direkt an den Durchgangsverkehr angebunden. Der Besucherstrom zum Paraklet hatte allmählich zugenommen, weil die berühmten Gründer des Klosters und ihre Schriften europaweit bekannt geworden waren. Die Brücke über den Ardusson bei Saint-Aubin bestand vermutlich noch fort. Ein alter Katasterplan des Paraklet von 1708 (siehe unten) bestätigt den neuen Straßenverlauf:
Es ist diese Strasse, die auch in einem Gesuch der letzten Äbtissin Charlotte de Roucy erwähnt wird, das sie 1790 an die Nationalversammlung in der Absicht richtete, um die Gefahr der Vertreibung zu bannen.
Das Kloster läge an der alten Route von Paris nach Troyes, und von Troyes käme man nach Lothringen, Franche-Comté und nach Burgund. Diese Straße sei als kürzestmögliche Route stark begangen - von Tausenden von Erntearbeitern und von Leuten in Not, die sich aus den genannten Landesteilen alljährlich in die Brie und nach Paris begäben. All diesen Menschen erweise man Hilfestellungen, die sie woanders nicht erhalten könnten... Die Äbtissinnen und die Nonnen bitten aus dem einen Wunsch heraus, nämlich dem höchsten Wesen angenehm und der Nation nützlich zu sein, dass man sie nicht nur nicht der Übungen beraubt, die ihren Herzen teuer sind, sondern dass man sie beauftragt, einige Betten zu unterhalten, wo sie persönlich Sorge tragen können für die Krankheiten ihres Geschlechts, wo doch der Paraklet das einzig offene Asyl auf einer Strecke von 16 bis 18 Ortschaften zwischen Provins und Troyes sei. Die genannte Gemeinschaft würde diese Verpflichtung vertraglich zusichern, wobei man diesen Werken des Mitleids den Ertrag des Bauernhofes, dessen Gebäude innerhalb der Klostereinfriedung lägen, noch hinzufügen würde.
Albert Willocx, Abélard, Heloïse et le Paraclet, 1996
Abaelards erstes Oratorium
Ich habe ein Oratorium aus Binsen und Stroh errichtet, wo ich mit einem unserer Kleriker im Verborgenen lebte...
Abaelard, Historia Calamitatum
Wenn Abaelard so viel im Paraklet schrieb, musste er ein All-Wetter-Skriptorium und eine Bibliothek gehabt haben. Vielleicht brachte er - so hat man vermutet - einen wesentlichen Bestand von Schriften aus Saint-Denis mit. Er kann nicht sehr viel in der Hütte aus Ried und Stroh, die er seiner Beschreibung nach zuerst erbaut hatte, gelesen oder geschrieben haben.
Michael Clanchy, Abelard, A Medieval Life, 1997
 Dieser Ansicht muss man sich nicht unbedingt anschließen. Welche ersten Gebäude hatte Abaelard erbaut, bzw. - wahrscheinlicher - erbauen lassen? Nötig war zunächst eine Kapelle für das Gebet und die Gottesdienste und eine stabiles, winterfeste Klause für zwei Personen als Bleibe. Die bäuerliche Bauweise war keineswegs primitiv, sondern entsprach Jahrhunderte alter, schon aus keltischer Zeit stammender Tradition. Man verwendete die Materialien, die einfach zu beschaffen waren. So entstand
wohl als erstes Oratorium ein Fachwerkbau in Holzständerbauweise - aus den Jungholzstämmen am Fluss
- mit einem wasserdichten Dach aus Ried - calamus - und Wänden aus Stroh - culmus - und Lehm. Abaelard selbst erwähnte die Baumaterialien in seiner Historia Calamitatum. In einer Kuhle präparierte man mit Wasser, Stroh und Lehm einen leichten, form- und transportierbaren Füllstoff, mit welchem man die Fachwerkfelder der Wände füllte. Nach dem Aushärten war dieses Mauerwerk sehr fest und verfügte über hervorragende Isolationseigenschaften. Diese Bauweise war einfach, aber zweckmäßig, und das Wohngebäude durchaus für einen längeren Aufenthalt geeignet. Es gibt somit keinerlei Anhalt dafür, dass - wie Clanchy vermutet - Abaelard in seiner Hütte nicht hätte überwintern, beziehungsweise an der Abfassung seiner Werke arbeiten können.
Dieser Ansicht muss man sich nicht unbedingt anschließen. Welche ersten Gebäude hatte Abaelard erbaut, bzw. - wahrscheinlicher - erbauen lassen? Nötig war zunächst eine Kapelle für das Gebet und die Gottesdienste und eine stabiles, winterfeste Klause für zwei Personen als Bleibe. Die bäuerliche Bauweise war keineswegs primitiv, sondern entsprach Jahrhunderte alter, schon aus keltischer Zeit stammender Tradition. Man verwendete die Materialien, die einfach zu beschaffen waren. So entstand
wohl als erstes Oratorium ein Fachwerkbau in Holzständerbauweise - aus den Jungholzstämmen am Fluss
- mit einem wasserdichten Dach aus Ried - calamus - und Wänden aus Stroh - culmus - und Lehm. Abaelard selbst erwähnte die Baumaterialien in seiner Historia Calamitatum. In einer Kuhle präparierte man mit Wasser, Stroh und Lehm einen leichten, form- und transportierbaren Füllstoff, mit welchem man die Fachwerkfelder der Wände füllte. Nach dem Aushärten war dieses Mauerwerk sehr fest und verfügte über hervorragende Isolationseigenschaften. Diese Bauweise war einfach, aber zweckmäßig, und das Wohngebäude durchaus für einen längeren Aufenthalt geeignet. Es gibt somit keinerlei Anhalt dafür, dass - wie Clanchy vermutet - Abaelard in seiner Hütte nicht hätte überwintern, beziehungsweise an der Abfassung seiner Werke arbeiten können. Alles zum Leben und Überleben zweier Männer Notwendige stand am Ardusson zur Verfügung: Der Bach selbst mit frischem Wasser und Fischen, Brennholz zum Heizen, Wildbret, Kräuter, Pilze und Beeren des Waldes. Es gab vermutlich auch saftige Auwiesen, geeignet für spätere Viehzucht oder Ackerbau.
Das Oratorium wurde vermutlich - entgegen Abaelards später gemachten Aussagen in der Historia Calamitatum - zunächst dem Patron von Abaelards Mutterkloster, dem Heiligen Dionysius, geweiht. Hierfür gibt es zumindest einige Anhaltspunkte. Abaelards Mutterkloster Saint-Denis, dessen Abt Abaelard selbst nach seiner Zeit im Paraklet noch mit noster abbas, unser Abt, bezeichnete, hatte im 12. Jahrhundert weite Teile des Umlandes in Besitz (siehe z.B. Benton, Cluny Conference, Seite 487).
In einer Kapelle in besagtem Kloster, die zu Ehren des Heiligen Dionysius gegründet worden ist...
Protokoll der Exhumation von 1497 - Archives de l'Aube
Die Nonnen des Paraklet ehrten speziell den Heiligen Dionysius, und Abaelard schrieb zwei Hymnen für sie zum Lob des Heiligen. In seiner Historia Calamitatum gestand Abaelard wahrscheinlich nicht ein, dass die erste Weihe auf den Heiligen Dionysius erfolgt war, sondern versuchte zu betonen, dass seine persönliche Weihe der Trinität gegolten habe... Michael Clanchy, Abelard, A Medieval Life, 1997
Als die Studenten das erfahren hatten, begannen sie von überall her zusammenzulaufen. Nachdem sie die Städte und Burgen verlassen hatten, wohnten sie jetzt in der Einöde, bauten sich an Stelle von stattlichen Häusern kleine Hütten, aßen statt köstlichen Speisen wilde Kräuter und einfaches Brot, legten sich statt in weiche Betten auf Binsen und Stroh, errichteten statt Tische Rasenbänke, so dass man hätte annehmen können, sie ahmten wirklich die alten Philosophen nach.
Abaelard, Historia Calamitatum
Damals hat vor allem die unerträgliche Armut mich veranlasst, eine Schule zu leiten, denn zu graben lag mir nicht und zu betteln schämte ich mich. So kehrte ich zu der Kunst zurück, die ich schon kannte und ich sah mich an Stelle der Handarbeit zum Dienst der Sprache veranlasst.
Abaelard, Historia Calamitatum
Die treulose Zunge des Dieners...
Hilarius, Elegie
Gern bereiteten mir meine Schüler zu, was ich an Nahrung und Kleidung brauchte, sie nahmen mir auch die Bestellung des Feldes und die Ausgaben für die Gebäude ab, damit mich keine wirtschaftliche Sorge von der Wissenschaft abhalte.
Abaelard, Historia Calamitatum
Da unsere Kapelle einen angemessenen Teil der Schüler nicht fassen konnte, so vergrößerten sie sie notgedrungen und bauten sie mit Steinen und Hölzern besser aus.
Abaelard, Historia Calamitatum
Wie dem auch sei - erst jetzt weihte Abaelard sein Oratorium der Heiligen Dreifaltigkeit - angespornt durch die Empörung seiner Schüler über seine Verurteilung auf dem Konzil von Soissons wegen Trinitätshäresie.
Als ich diese Kapelle zu Ehren des Heiligen Geistes gegründet und später geweiht hatte, habe ich sie, weil ich doch als Flüchtender und Verzweifelter durch die Gnade etwas an göttlichem Trost erfahren hatte, zum Andenken an diese Wohltat Paraklet genannt.
Abaelard, Historia Calamitatum
Die Schule beim Paraklet florierte: Statt einer Mönchsgemeinschaft bildete sich eine Art freie Universität - die erste auf europäischem Boden. Abaelard lehrte und schrieb ca. 4 Jahre. In diesen Jahren entstanden seine wichtigsten Werke, z.B. die Dialectica, die Theologia Christiana, Sic et Non, vermutlich auch die Collationes (Constant Mews, Peter Abelard, 1995).
Da der Zustrom an Hörern jedoch nicht nachließ, wurden allmählich die äußeren Rahmenbedingungen chaotisch. Vor allem fehlte es an ausreichender Nahrung. Manche Studenten begannen zu stehlen. Es kam zu Ärger mit den Bauern der umliegenden Dörfer. Ein aus dieser Zeit erhaltenes Gedicht des Scholaren Hilarius belegt, dass es zu zunehmenden Spannungen zwischen den Studenten und der Obrigkeit kam:
Verwünschenswert ist jener Bauer, durch den der Kleriker die Schule verlässt. Ein schlimmer Schmerz, dass ein Amtsamnn bewirkt hat, dass der Logiker jetzt geht.
Hilarius, Elegie
Soweit der historische Rückblick.
Der heutige Besucher des Paraklet sieht sich vor die Frage gestellt:
Wo genau lag Abaelards erstes Oratorium?
So bauten sich auch meine Schüler ihre kleinen Hütten am Ufer des Flusses Ardusson, und sie erschienen eher als Einsiedler denn als Studenten.
Abaelard, Historia Calamitatum
Wo verlief der Ardusson zur Zeit Abaelards?
 Zu Abaelards Zeit war der Ardusson ein relativ reich Wasser führendes und vermutlich fischreiches Flüsschen, das nach
Nordwesten der Seine zustrebte. Es gibt eindeutige Anhaltspunkte dafür, dass das ursprüngliche Flussbett stark geschlängelt, geradezu mäanderartig war. Wenn man allerdings die erste bekannte Darstellung des Paraklet-Klosters, eine Federzeichnung von 1548 (abgebildet z.B. in Roserot, Dictionnaire historique de la champagne meridionale, 1790) betrachtet, sieht man den Ardusson in relativ geradem Lauf am Kloster vorbeifließen. Diese Zeichnung ist jedoch in den Details so ungenau - zum Beispiel fehlt die Mühle - , dass daraus keine vorschnellen Schlüsse zu ziehen sind.
Zu Abaelards Zeit war der Ardusson ein relativ reich Wasser führendes und vermutlich fischreiches Flüsschen, das nach
Nordwesten der Seine zustrebte. Es gibt eindeutige Anhaltspunkte dafür, dass das ursprüngliche Flussbett stark geschlängelt, geradezu mäanderartig war. Wenn man allerdings die erste bekannte Darstellung des Paraklet-Klosters, eine Federzeichnung von 1548 (abgebildet z.B. in Roserot, Dictionnaire historique de la champagne meridionale, 1790) betrachtet, sieht man den Ardusson in relativ geradem Lauf am Kloster vorbeifließen. Diese Zeichnung ist jedoch in den Details so ungenau - zum Beispiel fehlt die Mühle - , dass daraus keine vorschnellen Schlüsse zu ziehen sind.
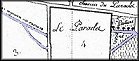 Einen begradigten Flusslauf belegt auch der alte Katasterplan von 1708 (abgebildet
z.b. in Roserot, Dictionnaire historique de la champagne meridionale, 1790): Hier erkennt man jedoch flussaufwärts eine Gabelung: Ein Flussarm fließt unmittelbar an den Konventgebäuden entlang und erlaubt die dortige Wasserentnahme, der zweite Arm, der Mühlbach, fließt in begradigtem Lauf weiter nördlich und versorgt die Mühle.
Einen begradigten Flusslauf belegt auch der alte Katasterplan von 1708 (abgebildet
z.b. in Roserot, Dictionnaire historique de la champagne meridionale, 1790): Hier erkennt man jedoch flussaufwärts eine Gabelung: Ein Flussarm fließt unmittelbar an den Konventgebäuden entlang und erlaubt die dortige Wasserentnahme, der zweite Arm, der Mühlbach, fließt in begradigtem Lauf weiter nördlich und versorgt die Mühle.
 Ein Kupferstich des Klosters aus der Zeit vor 1770 (veröffentlich in: "La Vallée et Brion,
Voyage dans les départements de la France. -Département de l'Aube", Paris
1793, Seite 20), der wahrscheinlich die Situation gegen Ende des 17. Jahrhunderts wiedergibt, bestätigt den klosternahen Arm des Ardusson. Er zeigt zum Teil auch Uferbäume, die noch heute in gleicher Anordnung nachweisbar sind. Dieser klosternahe Arm des Ardusson besteht jenseits des Querweges noch heute, wenngleich er auch immer mehr verkrautet. Der nördliche Mühlbach - der heutige Hauptarm - ist
auf den Stich von Bäumen verdeckt. Wann das esrte Mühlgebäude am nördlichen Arm errichtet wurde, ist unklar. Das heutige Gebäude soll laut Bauteile enthalten, die an eine sehr frühe Datierung denken lassen. Sie wurden bei einer persönlichen Inspektion jedoch nicht entdeckt. In die Zeit des ersten Oratoriums reichen sie keinesfalls zurück.
Ein Kupferstich des Klosters aus der Zeit vor 1770 (veröffentlich in: "La Vallée et Brion,
Voyage dans les départements de la France. -Département de l'Aube", Paris
1793, Seite 20), der wahrscheinlich die Situation gegen Ende des 17. Jahrhunderts wiedergibt, bestätigt den klosternahen Arm des Ardusson. Er zeigt zum Teil auch Uferbäume, die noch heute in gleicher Anordnung nachweisbar sind. Dieser klosternahe Arm des Ardusson besteht jenseits des Querweges noch heute, wenngleich er auch immer mehr verkrautet. Der nördliche Mühlbach - der heutige Hauptarm - ist
auf den Stich von Bäumen verdeckt. Wann das esrte Mühlgebäude am nördlichen Arm errichtet wurde, ist unklar. Das heutige Gebäude soll laut Bauteile enthalten, die an eine sehr frühe Datierung denken lassen. Sie wurden bei einer persönlichen Inspektion jedoch nicht entdeckt. In die Zeit des ersten Oratoriums reichen sie keinesfalls zurück.
Schließlich, in der Mauer der Mühle, über dem Wasserfall, ein Rundbogen mit einer Höhe von 2,50 m und Spannweite von 3 m, der bis ins späte 12. Jahrhundert zurückreichen dürfte.
Arbois de Jubainville: Répertoire archéologique du département de l'Aube, Paris, 1861
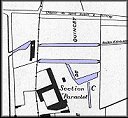 Ein Plan von 1809 stellt neben der mittelalterlichen Mühle sogar einen dreifaches Bett des Ardusson dar. Wasser führende Gräben nach Süden sind vermutlich Altwasserarme und somit Teile des ursprünglichen mäanderartigen Flussbettes. Diese Darstellung unterstützt die Annahme, dass der Fluss
in diesem Bereich und zu Zeiten Abaelards viel weiter südlich - in einer großen Schleife - verlief. Auch wenn man den heute noch unregulierten Abschnitt des Flusslaufes extrapoliert, projiziert sich das ursprüngliche Bett des Ardusson im Bereich des Paraklet viel weiter nach Süden.
Ein Plan von 1809 stellt neben der mittelalterlichen Mühle sogar einen dreifaches Bett des Ardusson dar. Wasser führende Gräben nach Süden sind vermutlich Altwasserarme und somit Teile des ursprünglichen mäanderartigen Flussbettes. Diese Darstellung unterstützt die Annahme, dass der Fluss
in diesem Bereich und zu Zeiten Abaelards viel weiter südlich - in einer großen Schleife - verlief. Auch wenn man den heute noch unregulierten Abschnitt des Flusslaufes extrapoliert, projiziert sich das ursprüngliche Bett des Ardusson im Bereich des Paraklet viel weiter nach Süden. Oberhalb des Paraklet und unterhalb von Saint-Aubin kann man den stark geschlängelten Verlauf des Ardusson an einzelnen Abschnitten nachvollziehen. Da der Fluss in der Frühzeit unreguliert war, werden im Frühjahr und Herbst Überschwemmungen die Regel gewesen sein, die ihrerseits dazu beitrugen, dass sich im Verlauf der Jahrhunderte im Bereich der Talaue der Boden in fruchtbares Schwemmland verwandeln konnte. Erst mit der Errichtung größerer Klostergebäude und der wirtschaftlichen Nutzung des Wasserlaufes wurde das Bett des Ardusson begradigt und weiter nach Norden verlegt. Die Konventgebäude mussten durch die genannten Drainagegräben von der Staunässe entlastet werden.
Das heutige Flussbett des Ardusson ist kaum mehr als 170 Jahre alt: Baron Charles Walckenaer hatte am 26. Mai 1830, ca. 40 Jahre nach der Zerstörung des Klosters, das Paraklet-Areal vom Ehepaar Beauvallet für die Summe von 96000 Franc erworben. Um die wirtschaftliche Nutzung der sumpfigen Flussauen zu verbessern und einen effektiven Mühlbetrieb zu ermöglichen, erhöhte er den Wasserstand des Zulaufes erheblich. Dazu musste er ihn eine weite Strecke flussaufwärts eindeichen. Zur Verhinderung von Erdeinschwemmungen, welche den Mühlbetrieb hätten behindern können, dämmte Walckenaer auch das rechte, hangseitige Ufer und versah es mit einem vorgeschalteten Drainagegraben. Flussabwärts vertiefte er das Bett. Nur so erreichte er eine wirtschaftlich nutzbare Wasserfallhöhe von 2.80 Meter auf Höhe des ehemaligen Konventgebäudes. Dadurch konnte er mit einem Wasserrad von 5 m 60 Durchmesser 12 Pferdestärken erzeugen (nach Willocx). Vermutlich wurde in dieser Zeit auch das Mühlgebäude des Paraklet, das noch heute bewohnt ist, neu gestaltet. Die Kanalisierung und Begradigung besteht bis in unsere Tage; sie ist auf folgender Luftaufnahme problemlos nachzuvollziehen:

Bitte mit der Maus über die Karte fahren!
Flussabwärts ist der mittelalterliche Verlauf noch gut an einer verbliebenen, hell belaubten Uferbepflanzung zu erkennen (hellblaue Punkte), die auch auf den Kupferstichen zur Darstellung kommt. Eine kurze Flussstrecke bei Quincey wurde offensichtlich nie begradigt; sie repräsentiert den einstmaligen, naturbelassenen Verlauf des Flüsschens (rechts im Bild). Es ist anzunehmen, dass sich dieser geschlängelte Verlauf auch flussabwärts fortsetzte. Das ursprüngliche Flussbett erkennt man noch vereinzelt an Vertiefungen im Gelände (grüne Linie). Östlich des vormaligen Klosters ist in einer Niederung dichter Baumbestand zu erkennen. Aller Wahrscheinlichkeit nach lag Abaelards erstes Oratorium flussnah - an der südlichen, linken Talseite, vielleicht auf einer von Südwesten einstrahlenden Landterrasse mit trockenem Terrain, um welches der Fluss mäanderartig bog (violetter Punkt). Die weitere Baugeschichte des Paraklet wird diesen Standort untermauern. Doch dazu mehr an anderer Stelle. Die Ansicht mancher Autoren (Charrier, Willocx), dass Abaelards Gründung in Bereich des heutigen Mühlgebäudes lag, ist nach den gewonnenen Erkenntnissen auf jeden Fall äußerst unwahrscheinlich. Aufgrund neuerer Erkenntnisse ist es jedoch nicht wahrscheinlich, dass das Oratorium an der Stelle lag, wo heute ein inschriftloser Obelisk über einer Gruft Abaelards und Heloïsas Begräbnisstätte kennzeichnen soll. Hierauf wird weiter unten noch eingegangen.
Die Klosteranlage
...erkannte ich, dass der Herr selbst mir hier eine Gelegenheit biete, für mein Oratorium zu sorgen. Ich kehrte nun dorthin zurück und lud Heloïsa mit den wenigen Nonnen aus ihrer Kongregation, die noch an ihr hingen, nach dem Paraklet ein. Als ich sie dorthin geführt hatte, übereignete und schenkte ich ihnen das Oratorium mit allem, was dazugehörte. Und diese Schenkung hat, dank der Zustimmung und Verwendung des Landesbischofs, Papst Innozenz II. ihnen und ihren Nachfolgerinnen durch ein Privilegium für alle Zeiten bestätigt.
Abaelard, Historia Calamitatum
Und nach einem Jahr - Gott mag es bezeugen - waren sie an irdischem Besitz reicher, als ich es geworden wäre, wenn ich hundert Jahre dort gelebt hätte. Denn eben weil das weibliche Geschlecht das schwächere ist, um so Mitleid erregender weckt seine Hilfsbedürftigkeit das menschliche Mitgefühl, und die Tugend der Frauen ist vor Gott und den Menschen um so angenehmer. Gott aber verlieh unserer geliebten Schwester, die den anderen vorstand, in aller Augen so viel Gnade, dass die Bischöfe sie wie eine Tochter, die Äbte wie eine Schwester, die Laien wie eine Mutter liebten, und alles bewunderte gleichermaßen ihre Frömmigkeit, Klugheit und in allen Lagen unvergleichliche Sanftmut und Geduld.
Abaelard, Historia Calamitatum
Wilhelm von Curgivolt und Girardus Berengarius spendeten das Nutzrecht ihrer Wälder für den Bau der Häuser und der Schweineställe, und alles, was zum Bau notwendig war...
Urkunde von 1194
Abaelard selbst versorgte den Konvent auf Bitten seiner vormaligen Frau mit dem theologischen Unterbau. Er dichtete und komponierte Hymnen und Sequenzen, legte eine Predigtsammlung an und schrieb einen exegetisch belegten Regelentwurf. Diesem Entwurf entnimmt man, dass sich Abaelard nicht im Grundsätzlichen von der benediktinischen Regel entfernte. Seine originäre Leistung bestand jedoch darin, die Einzelvorschriften auf die Bedürfnisse von Frauen abzustellen und dies exegetisch zu untermauern.
Somit kann man davon ausgehen, dass das neuerbaute Kloster Heloïsas in vielen Teilen den Konzepten der französischen Reformklöster des 12. Jahrhunderts entsprach. Die Beschränkung der Mittel, die Abneigung gegen einen großen Konvent und die besonderen Besitzverhältnisse am Ardusson verboten jedoch eine weitläufige Klosteranlage:
Noch heute verläuft quer durch das Paraklet-Gelände die Gemeindegrenze zwischen Saint-Aubin und Quincey. Sie ist auch deutlich auf dem Katasterplan von 1809 (siehe unten) zu erkennen. Diese Grenze wurde bereits um 1500 durch eine Untersuchung bestätigt: Die Scheunen, Ställe und die Mühle lagen auf dem Territorium von Saint-Aubin, die Abtei selbst auf dem Territorium von Quincey. Zwischen den beiden Arealen verlief auf der Gemeindegrenze: "la chaussee ou grant chemyn passant par devant la dicte abbaye, parmi les portes d'icelle", d.h. der große Weg ging an der besagten Abtei vorbei, durch das Tor (Archives Aube, zitiert nach Roserot, Dictionnaire historique de la champagne meridionale, 1790).
Es handelte sich hierbei vermutlich um eine aus dem Frühmittelalter stammende Grenze, wie im Folgenden zu zeigen sein wird: Abaelards erstes Besitztum lag auf dem Gebiet von Quincey. Den oder die Vorbesitzer hat er in der Historia Calamitatum verschwiegen. Eine Ausdehnung der Klosteranlage unter Heloïsa war nach Osten und Norden nicht möglich, da der Flusslauf dies verhinderte.
Die Urkunden des Paraklet zwischen 1146 und 1194, die im Cartularium des Paraklet erhalten sind, weisen die Klostergründung Heloïsas als Resultat einer großen Landschenkung aus, durchgeführt durch Milo, den Herrn von Nogent, und seinen Verwandten und seinen Lehensleuten. Dahinter stand jedoch - wie in einer Urkunde erwähnt - eine starke Hand: Theobald, Graf der Champagne, und seine Gattin. In den Urkunden werden zahlreiche Spender, wohl meistens Lehensnehmer Milos, genannt. Es ging darum, dem Paraklet eine möglichst große, wenn auch nicht immer geschlossene Landmasse für das Fortbestehen zu sichern. Ob Abaelard in die betreffenden Verhandlungen aktiv eingeschaltet war, darf bezweifelt werden.
- Abaelards erstes Oratorium war auf einem abgabenfreien Allodialgut eines gewissen Simon von Nogent, eines Aftervasallen des Milo von Nogent, errichtet worden. Da auf diesem Grundstück keine weiteren Feudalrechte
lasteten, dürfte Abaelard den Besitzübergang auf Heloïsa relativ formlos - vermutlich privatschriftlich - vollzogen haben. Eine Urkunde darüber hat sich nicht erhalten.
Simon de Nogennio dedit de alodio suo culturas, unam in qua ipsum Oratorium constructum est et aliam in Monte Limarsum.
Simon von Nogent gab aus seinem Allodialbesitz Kulturland: ein Grundstück, auf welchem das Oratorium errichtet wurde und ein anderes auf dem Berg Limarsum.
Urkunde von 1194
- Ob dieses Land und die Person identisch ist mit den im folgender Urkunde erwähnten, muss offen gelassen werden. Hier ist von Verkauf die Rede. Abaelard hatte dagegen beim Besitzübergang des Oratoriums auf Heloïsa von Geschenk gesprochen.
Totam terram quam vendidit vobis Simon de Nucs, quam habebat, citra aquam...
Das ganze Land, das Euch Simon von Nucs (verballhornt Nogent?) verkaufte, welches er diesseits des Wassers hatte...
Bulle von Papst Lucius vom 15. Februar 1182
Hier wie in allen weitern Urkunden findet Abaelard keine Erwähnung. Da die Urkunden nahezu alle nach der Zeit seiner Verurteilung auf dem Konzil von Sens im Jahre 1142 datieren, dürfte der Grund in eben dieser Verurteilung zu sehen sein. Selbst Heloïsa wird aus Gründen der Rechtssicherheit ein Interesse daran gehabt haben, dass der Name ihres Gatten in den Urkunden nicht auftauchte. Ansonsten fällt in den Urkunden auf, dass die Namen der Spender nicht immer identisch sind; mitunter wurden Lehensherr und Lehensnehmer gleichgesetzt:
- Die Schenkung bzw. der Verkauf des Milo von Nogent selbst enthielt wahrscheinlich Grundstücke in Richtung Saint-Aubin:
Quidquid habetis ex venditione seu donatione Milonis: duo jugera terre ante ipsum monasterium... aliam terram in eodem loco...
Was ihr aus dem Verkauf oder der Schenkung des Milo habt: zwei Joche Land vor dem Kloster... und noch anderes Land ebendort...
Bulle von Papst Eugen II. vom 11. November 1147
- Diese Grundstücke sind andernorts präzisiert; der Ort Charmoy besteht heute noch; Brûlé ist heute nicht mehr nachweisbar:
Quod Milo, dominus Nogentii laudavit ecclesie Paraclitensi... terram ad Charma usque ad molendinum sub via que venit Paraclitum; culturam unam que est inter Brusletum et viam...
Was Milo, der Herr von Nogent, der Kirche des Paraklet vermachte... Land bei Charmoy bei der Mühle unterhalb des Weges, der zum Paraklet führt und eine Kultur, die zwischen Brulé und dem Weg liegt...
Urkunde von Graf Theobald von 1146
Milo, dominus Nogentii, in cujus territorio Paraclytense constructum est Oratorium, ei loco donavit culturas tres; unam inter Brusletum et viam; alteram juxta Carmam; tertiam juxta viam Triagnelli ad sinistram...
Milo, der Herr von Nogent, auf dessen Territorium das Oratorium des Paraklet errichtet worden ist, hat diesem Ort drei Parzellen Kulturland geschenkt: eine zwischen Brulé und dem Weg, eine andere neben Charmoy, eine dritte links des Weges nach Traînel...
Urkunde von 1194
- Dass die zwei Joche Land vor dem Paraklet, die oben dem Milo zugeschrieben worden waren,
wahrscheinlich vorher einem Hubert von Nogent entlehnt waren, entnehmen wir dieser Angabe:
Hubertus de Nogennio dedit duo jugera terre ante ipsum Oratorium, per manum Milonis de Nogennio...
Hubert von Nogent gab zwei Joche Land gerade vor dem Oratorium, auf Veranlassung des Milo von Nogent...
Urkunde von 1194
- Rainald, der Sohn Milos, verzichtete zugunsten des Paraklet
auf die Flussaue bis Quincey:
Totam terram, quam Rainaldus habebat in parochia de Quinceio, ex utraque parte fluvioli Arducionis...
Das ganze Land, das Rainaldus in der Pfarrei Quincey besaß, beiderseits des Flüsschens Ardusson...
Bulle von Papst Eugen II. vom 11. November 1147
- Einen Tag nach dem Einzug der Nonnen im Paraklet schenkte Milo diesen auch noch das dazugehörige Fischrecht
zwischen Quincey und Saint-Aubin:
Die insuper illo quo sanctimoniales Oratorium ingresse possederunt, donavit eis piscaturam totam Arducionis fluminis penitus immunem a Sancto Albino usque Quinceium...
Am Tage nach der Besitznahme und dem Einzug der Nonnen ins Oratorium schenkte er ihnen das ganze Fischrecht des gänzlich unbefestigten Flusses Ardusson von Saint-Aubin bis Quincey...
Urkunde von 1194
- Offensichtlich gab Milo, nachdem Comitissa, die Nichte des Milo, als Nonne im Paraklet aufgenommen worden war, auch noch den Backofen von Saint-Aubin samt zugehörigem Holz dem Paraklet, sein Bruder Milo Sanctus die Hälfte des Ofens von Quincey:
Comitissa, nepta sua, in sanctimonialem suscepta, dedit furnum de Sancto Albino cum usuario nemoris quod furnus habebat ... Milo Sanctus pro filia sua Comitissa, dimidium furnum Quinceii, per manum domini Milonis...
Comitissa, seine Nichte, wurde als Nonne aufgenommen. Da gab er den Backofen von Saint-Aubin mit dem Nutzrecht des Waldes, der zum Ofen gehörte... Milo Sanctus für seine Tochter Comitissa die Hälfte des Ofens von Quincey, auf Veranlassung des Herrn Milo...
Urkunde von 1194
(alle Angaben nach Lalore, Cartulaire de l'Abbaye du Paraclet, 1878)
Obwohl uns Bilddarstellungen aus dem 12. Jahrhundert fehlen, sind aufgrund der vorhandenen Quellen zahlreiche Rückschlüsse auf Heloïsas Klosteranlage möglich:
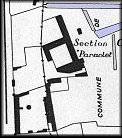 Das
Prinzip der Klosteranlage wird wenig von den Konzepten der Zisterzienser abgewichen sein. Es hatte einen zweckmäßigen, fast quadratischen Grundriss; der Chor der Abteikirche war wie üblich nach Osten ausgerichtet. Selbst der Katasterplan aus Quincey von 1809 , der 15 Jahre nach der Zerstörung des Klosters angefertigt wurde, weist trotz der dazwischen liegenden Jahrhunderte die entsprechenden Flächen aus (siehe Bild links; Roserot, Dictionnaire historique de la champagne meridionale, 1790).
Es gibt relativ eindeutige Belege dafür, dass die Ausrichtung des inneren Klostergevierts nach der Klostergründung nie entscheidend verändert wurde, trotz der späteren Zerstörungen, Erweiterungen und Neubauten. Es ist allenfalls möglich, dass - wegen der unterschiedlichen Dimensionen der einstigen und späteren Abteikirche - der innere Klosterbezirk respektive der Kreuzgang im 17. und/oder 18. jahrhundert nach Nordwesten etwas erweitert wurde. Der südöstliche Bereich des Kreuzganges und die daran angrenzenden Gebäude gehörten bis zuletzt zur ältesten Bausubstanz. Hierauf wird noch näher einzugehen sein. Das Totenbuch des Paraklet, das in zwei Fassungen - lateinisch und altfranzösisch; von Beginn an bis ins 18. Jahrhundert - erhalten ist, untermauert dies an zahlreichen Stellen. Es beschreibt mehrere bis ins 12. Jahrhundert zurückreichende Grablegen, die immer an Ort und Stelle innerhalb des Klostergevierts verblieben sind. Bei größeren Umgestaltungsmaßnahmen hätten sie verlegt werden müssen.
Das
Prinzip der Klosteranlage wird wenig von den Konzepten der Zisterzienser abgewichen sein. Es hatte einen zweckmäßigen, fast quadratischen Grundriss; der Chor der Abteikirche war wie üblich nach Osten ausgerichtet. Selbst der Katasterplan aus Quincey von 1809 , der 15 Jahre nach der Zerstörung des Klosters angefertigt wurde, weist trotz der dazwischen liegenden Jahrhunderte die entsprechenden Flächen aus (siehe Bild links; Roserot, Dictionnaire historique de la champagne meridionale, 1790).
Es gibt relativ eindeutige Belege dafür, dass die Ausrichtung des inneren Klostergevierts nach der Klostergründung nie entscheidend verändert wurde, trotz der späteren Zerstörungen, Erweiterungen und Neubauten. Es ist allenfalls möglich, dass - wegen der unterschiedlichen Dimensionen der einstigen und späteren Abteikirche - der innere Klosterbezirk respektive der Kreuzgang im 17. und/oder 18. jahrhundert nach Nordwesten etwas erweitert wurde. Der südöstliche Bereich des Kreuzganges und die daran angrenzenden Gebäude gehörten bis zuletzt zur ältesten Bausubstanz. Hierauf wird noch näher einzugehen sein. Das Totenbuch des Paraklet, das in zwei Fassungen - lateinisch und altfranzösisch; von Beginn an bis ins 18. Jahrhundert - erhalten ist, untermauert dies an zahlreichen Stellen. Es beschreibt mehrere bis ins 12. Jahrhundert zurückreichende Grablegen, die immer an Ort und Stelle innerhalb des Klostergevierts verblieben sind. Bei größeren Umgestaltungsmaßnahmen hätten sie verlegt werden müssen.
Die Existenz alter Bauteile bestätigte auch ein Besucher, der noch kurz vor der Zerstörung der Abtei diese aufgesucht hatte. Seinen Bericht hatte 1809 der Engländer Crawfurd festgehalten:
Die alte Kirche, der Kreuzgang, der Saal mit dem Namen "Das Kapitel" und ein Schlafsaal, alles von Heloïse errichtete Gebäude, standen noch, mit ihren Täfelungen, denen ähnlich, die Sie aus alten gotischen Gebäuden kennen.
Crawfurd, Mélanges d'Histoire et de Littérature tirés d'un portefeuille, 1809
...Ihr habt bei uns vergangenes Jahr am 16. November eine Messe gelesen und uns dem Heiligen Geiste anempfohlen. Im Kapitel habt ihr uns mit dem Segen einer gottgefälligen Predigt gespeist...
Heloïsa, Brief 2 an Petrus Venerabilis
.... wurde beim Paraklet bestätigt, gerade in dessen Kapitelsaal, in Gegenwart der Herrn Milo von Nogent
Abbé Lalore, Cartulaire de l'abbaye du Paraclet, Paris, 1878
Noch zu Lebzeiten Heloïsas expandierte der Klosterverband - durch die Gründung von mehreren Prioraten. Näheres hierzu findet man unter: Geschichte des Paraklet. Mehrere Papstbullen und Urkunden aus dem Kartularium des Paraklet belegen die Prosperität der damaligen Zeit. Ab 1136 wird Heloïse in den Bullen entgültig als abbatissa, d.h. Äbtissin - an Stelle von priorissa, d.h. Priorin - tituliert. Diese Quellen enthalten leider nur wenige Angaben zu den baulichen Gegebenheiten des Paraklet, so dass aus ihnen weitere Rückschlüsse zur Architektur des Paraklet nicht zu ziehen sind.
Im 14. Jahrhundert, während des Hundertjährigen Krieges, wurde die Klosteranlage durch die marodierenden Banden des Eustache d'Auberticourt weitgehend zerstört. Dies ist durch Dokumente des Bischofs von Troyes gesichert. Eine Bulle von 1366 beschreibt: totum destructum usque ad aream, d.h. zerstört bis auf Grund und Boden. Diese Angabe darf jedoch nicht überbewertet werden. Es ist weitgehend sicher, dass nicht alle Bauteile zerstört wurden. Nach den Heimsuchungen wurde der Konvent wieder aufgebaut, dabei vermutlich die Abteikirche nach Westen erweitert. Dies wird weiter unten noch näher begründet werden. Der Wiederaufbau der Abtei nahm sehr viel Zeit in Anspruch. Noch 1396 lag das Kloster in Trümmern. Vollendet wurde der Wiederaufbau erst unter Jehanne des Barres, dank der Gaben von Privatleuten. Diese wurden durch eine Bulle von Papst Benedikts XIII. vom 1. Februar 1396 zum Wiederaufbau aufgerufen - mit der Versprechung eines Nachlasses ihrer Sünden. In dieser Bulle bestätigte Papst Benedikt, dass nicht alle Gebäude zerstört waren:
Da also, wie wir vernommen haben, die Kirche und andere Gebäude des Klosters der Nonnen des Paraklet vom Orden des Heiligen Benedikt in der Diözese Troyes wegen der Kriege, die in jenem Landesteil allzu lange gewütet haben, so sehr zerstört worden sind, dass sie durch die Almosen derer, die an Christus glauben, nicht ausreichend repariert werden können.
Bulle von Papst Benedikts XIII vom 1. Februar 1396
Wenig hilfreich zur Beurteilung der frühen Klosteranlage ist die bereits oben gezeigte, älteste Federzeichnung des Paraklet aus dem Jahre 1548. Sie stellt - bei vielen weiteren Ungenauigkeiten - nur das Kirchenschiff, nicht das eigentliche Klostergeviert dar. Auch die Anordnung der anderen Gebäude ist wenig plausibel. Eine Darstellung der Mühle fehlt gänzlich.
Le petit moustier
im kleinen Kreuzgang am Tor zum Kloster
Totenbuch des Paraklet
Das gemeinsame Grab Heloïsas und Abaelards lag in der Kapelle selbst. Catherine II. de Courcelles, die 17. Äbtissin, amtierend von 1481 bis 1513, organisierte die erstmalige Umbettung der Leichname des Gründerpaares vom Oratorium petit moustier in den Chor der großen Abteikirche.
Das Totenbuch des Paraklet führt aus:
Am 7. Mai (!) des Jahres 1497 wurden die Gebeine der Heloïsa, die an einem Ort dieses Klosters namens "le petit moustier" geruht hatten, gehoben und in die Kirche verbracht ... am 2. Mai die Gebeine des Gründers Petrus, die an demselben Ort geruht hatten...
Totenbuch des Paraklet MS Troyes Bibl. Mun. 2450
Sie hat die Gebeine bzw. Leichname des verstorbenen Meisters Peter Abaelard, des ersten Gründers der genannten Kirche des Paraklet, und der verstorbenen Heloïsa, der ersten Äbtissin des Klosters, überführen lassen, von einem feuchten und wasserreichen Ort, nämlich der Kapelle, die in besagtem Kloster zu Ehren des Heiligen Dionysius gegründet worden war und gewöhnlich "petit moustier" genannt wird, wo die erwähnten Leichname freilich seit langer Zeit vor der derartigen Überführung, wie man sagte, bestattet oder vergraben lagen, und sie hat dieselben Gebeine begraben oder bestatten lassen, getrennt, an zwei Stellen des Chores der anfangs genannten Kirche des Paraklet...
aus Charlotte Charrier, Heloïse dans l'histoire et dans la légende, Paris, 1933
Der Standort der Begräbnisstätte "le petit moustier" entsprach ziemlich sicher dem des ersten Oratoriums Abaelards. Abaelard hatte persönlich darum gebeten, dort bestattet zu werden:
Lässt mich der Herr in die Hände meiner Feinde fallen, so dass sie mich überwältigen und töten, oder gehe ich sonst wie ferne von Euch den Weg alles Fleisches, so bitte und beschwöre ich Euch: wo immer mein Leib unter der Erde oder über der Erde liege, lasst ihn auf Euren Gottesacker überführen! Unsere Töchter, vielmehr unsere Schwestern in Christo Jesu, mögen sich dann durch den Anblick meines Grabes noch mehr ermuntern lassen, für mich Gebete zum Himmel empor zu senden.
Abaelard, Brief 3 an Heloïse
Dorthin, ins Paraklet-Kloster, war in der Tat Abaelards Leichnam durch Petrus Venerabilis, Großabt von Cluny, auf Bitten Heloïsas verbracht worden - furtim, d.h. verstohlen. Die Angabe bezog sich auf den Transport, nicht primär auf die Exhumierung:
Ich, Petrus, Abt von Cluny, der ich Petrus Abaelard als Mönch in mein Kloster (Cluny) aufgenommen habe, habe seinen Leichnam verstohlen überführen lassen und der Äbtissin Heloïsa und den Nonnen des Klosters Paraklet übergeben...
Petrus Venerabilis, Absolutio Petri Abaelardi
An seinem Grab ist folgender Epitaph angebracht: Genug ist in diesem Grab. Peter Abaelard liegt hier, dem allein offen stand, was auch immer zu wissen war.
Godel, Chronik von 1173
Noch kurz vor der französischen Revolution hatte ein Besucher die alte Kirche, wie er sie nannte, gesehen und beschrieben - im Pathos der damaligen Zeit:
Es gibt in der alten Kirche, die dunkel und sehr feucht ist, einen Altar aus grobem Stein, dem sich Heloïse einst mehrfach täglich zu Füßen warf, zweifelsohne, um das Unglück ihres Geliebten und späteren Ehemannes und auch das eigene zu beweinen.
Crawfurd, Mélanges d'Histoire et de Littérature tirés d'un portefeuille, 1809
Es sind im Wesentlichen zwei Standorte, welche als erste Begräbnisstätte Heloïsas und Abaelards in Frage kommen:
Hypothese 1: Lage des petit moustier im Osten der Abtei, hinter dem Chor der Abteikirche
Dies entspricht der traditionellen Deutung. Einer der Nachbesitzer des Paraklet, der Generalleutnant Graf Pajol, ruhmreicher Soldat des ersten Reiches, hatte 1821 das Klosterareal für 40000 Francs durch einen Mittelsmann ersteigert. Als Peer von Frankreich, Träger des Großkreuzes der Ehrenlegion und Kommandant der 1. Division hatte er in einem erinnerungswürdigen Kavalleriestreich im Jahre 1814 Montereau befreit. Graf Pajol und seine Frau, Tochter des Marschalls Udinot, kümmerten sich nach dem Erwerb auch um die Überreste der vormaligen Abtei. Sie fanden eine Grablege:
Inmitten des Schuttes legte der General das Grabgewölbe frei, wo die sterblichen Überreste von Abaelard und Heloïse über 8 Jahrhunderte geruht hatten, und in welchem sie - zusammen mit dem Sarg, in dem die beiden Leichname verwahrt waren - einen Sarkophag fanden, der zu schwer war, um nach Paris überführt zu werden. Diesen Sarkophag ließen sie restaurieren und in das Gewölbe zurückplatzieren, anschließend den Eingang verschließen. Um die Stelle zu kennzeichnen, ließ der Eigentümer an Ort und Stelle eine Votivsäule errichten.
Guide pittoresque du voyageur en France, Paris, 1838
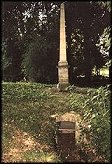 General Pajol und seine Gattin
hielten demnach dieses Grabgewölbe für das erste gemeinsame Grab des Gründerpaares. Es handelt sich ein kleines Tonnengewölbe, mit einem breiten Gesims am Ende, vermutlich einem Altartisch, sowie eine über Eck gekreuzte Bodenplatte, welche einst die Särge getragen haben soll. Von einem Sarkophag ist heute nichts mehr bekannt. Dass dieser vom Guide pittoresque erwähnte Sarkophag der Originalsarg von Abaelard und Heloïse aus dem 12. Jahrhundert war, ist eher unwahrscheinlich. Im übrigen hatten die Leichname sowieso nicht über 800 Jahre ungestört in ein und derselben Grablege geruht, sondern waren im Laufe der Jahrhunderte mehrfach umgebettet worden.
General Pajol und seine Gattin
hielten demnach dieses Grabgewölbe für das erste gemeinsame Grab des Gründerpaares. Es handelt sich ein kleines Tonnengewölbe, mit einem breiten Gesims am Ende, vermutlich einem Altartisch, sowie eine über Eck gekreuzte Bodenplatte, welche einst die Särge getragen haben soll. Von einem Sarkophag ist heute nichts mehr bekannt. Dass dieser vom Guide pittoresque erwähnte Sarkophag der Originalsarg von Abaelard und Heloïse aus dem 12. Jahrhundert war, ist eher unwahrscheinlich. Im übrigen hatten die Leichname sowieso nicht über 800 Jahre ungestört in ein und derselben Grablege geruht, sondern waren im Laufe der Jahrhunderte mehrfach umgebettet worden.
 Im Jahre 1832 (1835?) verkaufte der mittlerweile verwitwete Graf Pajol das Klostergelände mit dem Gutshaus an Baron Charles Walckenaer. Obwohl dieser im Zuge seiner umfangreichen Rekultivierungsmaßnahmen das ganze Gelände aufschütten und trockenlegen ließ, hat er die Stelle der von Pajol aufgefundenen Krypta ausgespart.
Der Obelisk aus grauem Stein steht heute noch, der Eingang des Grabgewölbes ist
vergittert.
Im Jahre 1832 (1835?) verkaufte der mittlerweile verwitwete Graf Pajol das Klostergelände mit dem Gutshaus an Baron Charles Walckenaer. Obwohl dieser im Zuge seiner umfangreichen Rekultivierungsmaßnahmen das ganze Gelände aufschütten und trockenlegen ließ, hat er die Stelle der von Pajol aufgefundenen Krypta ausgespart.
Der Obelisk aus grauem Stein steht heute noch, der Eingang des Grabgewölbes ist
vergittert.
C. Charrier hielt dieses Gewölbe für die letzte Ruhestätte des Gründerpaares, welche jedoch in der Vierung der großen Abteikirche lag (siehe weiter unten). Die Krypta unter dem Chor der vormaligen Abteikirche ist noch - mittlerweile von oben durch eine Betonplatte geschützt - erhalten. Sie liegt in zirka 9 Meter Entfernung achsengerecht genau westlich dieser Gruft. Hinter der mit dem Obelisken gekennzeichneten Stelle ist kein weiteres, zum Chor gehöriges Kirchenfundament mehr anzunehmen; vielmehr findet sich abschüssiges, etwas sumpfiges, vormals baumbestandenes Gelände - das ehemalige Flussbett des Ardusson (siehe oben). Die großen Bäume wurden alle durch einen Sturm am 26. Dez. 2000 entwurzelt, so dass die Stelle im Jahr 2001 einem Kahlschlag gleicht. Deshalb ist Charriers Ansicht einer Vierungskrypta nicht plausibel. Wegen der großen Distanz zur Krypta des Chores ist aber auch eine isolierte Lage im Bereich des kurzen Chorschlusses wenig plausibel. Somit scheint diese Gruft außerhalb des Chorschlusses der Abteikirche - eine runde Apsis ist ebenfalls wenig wahrscheinlich - gelegen zu haben. Sollte also das petit moustier eine Kapelle hinter der Kirche dargestellt haben? Und wo war dann der aus dem Totenbuch her bekannte petit cloître und das Tor zum Kreuzgang? All diese offenen Fragen sind heute nicht mehr eindeutig zu beantworten und lassen an der Theorie zweifeln.
 Immerhin gibt ein Kupferstich nach einem Motiv von Delaval, graviert von Baugean um 1795, also zur Zeit des Abbruchs der Abtei, gibt interessante Details aus diesem östlichen Bereich des Klosters wieder. Doch auch dieser Stich bringt keine Klärung. Auffallend ist, dass die vormaligen Westfronten der Gebäude noch standen. Die damaligen Abbrucharbeiten wurden demnach von Osten, von Quincey aus, bewerkstelligt - nicht ungewöhnlich, da ja - wie oben nachgewiesen wurde - das Klostergeviert auf dem Gebiet von Quincey,
exakt an der Gemeindegrenze, stand. Die Abteikirche ist bereits bis auf das Westwerk abgerissen. In Bildmitte erkennt man Teile der westlichen Mauer des großen Kreuzgangs mit Rundbogen und Eingangstor. Die Gebäude rechts der Bildmitte sind in ihrer Funktion unklar; sie stammen vermutlich aus späterer Zeit. Der rechte Bildrand zeigt gerade noch ein kleineres Gebäude mit einer Begrenzungsmauer und einem Baum. Unwillkürlich denkt
man erneut an das petit moustier mit dem petit cloître. Doch dies ist mehr als spekulativ; die Distanz zum vormaligen Chor der Abteikirche - etwa in Höhe des Weges und der Bauersfrau - erscheint viel zu groß, und die Funktion der weiteren Gebäude wäre dann schier unerklärlich.
Immerhin gibt ein Kupferstich nach einem Motiv von Delaval, graviert von Baugean um 1795, also zur Zeit des Abbruchs der Abtei, gibt interessante Details aus diesem östlichen Bereich des Klosters wieder. Doch auch dieser Stich bringt keine Klärung. Auffallend ist, dass die vormaligen Westfronten der Gebäude noch standen. Die damaligen Abbrucharbeiten wurden demnach von Osten, von Quincey aus, bewerkstelligt - nicht ungewöhnlich, da ja - wie oben nachgewiesen wurde - das Klostergeviert auf dem Gebiet von Quincey,
exakt an der Gemeindegrenze, stand. Die Abteikirche ist bereits bis auf das Westwerk abgerissen. In Bildmitte erkennt man Teile der westlichen Mauer des großen Kreuzgangs mit Rundbogen und Eingangstor. Die Gebäude rechts der Bildmitte sind in ihrer Funktion unklar; sie stammen vermutlich aus späterer Zeit. Der rechte Bildrand zeigt gerade noch ein kleineres Gebäude mit einer Begrenzungsmauer und einem Baum. Unwillkürlich denkt
man erneut an das petit moustier mit dem petit cloître. Doch dies ist mehr als spekulativ; die Distanz zum vormaligen Chor der Abteikirche - etwa in Höhe des Weges und der Bauersfrau - erscheint viel zu groß, und die Funktion der weiteren Gebäude wäre dann schier unerklärlich.
Hypothese 2: Lage des petit moustier im Nordosten des Klostergevierts, nahe am Ufer des Ardusson
Aufgrund einer Vermessung des Areals um 1808 ist auch ein anderer Standort möglich, vielleicht sogar wahrscheinlicher:
 Der relativ genaue Katasterplan, der ja nur noch aufgrund der im Boden verbliebenen Fundamentierung erstellt werden konnte, gibt lediglich die Grundrisse der historischen Klostergebäude (Konvent, Mühle, Gutshof) wieder, nicht jedoch die nach den Bilddarstellungen des 18. Jahrhunderts reichlich vorhandenen Zusatzgebäude - mit Ausnahme eines kleinen Gebäudes in Nordosten hinter den Konvent. Für die davor dargestellte und unharmonisch wirkende Verlängerung des Ostflügels nach Norden - mit einem Fragezeichen gekennzeichnet - gibt es aufgrund der sonstigen Quellen keine Evidenz; vielmehr floss hier der klosternahe Arm des Ardusson. Entweder wurde hier ein Brückenbauwerk oder ein rechts des Ardusson liegendes Gebäude messtechnisch miterfasst, oder es überspannte in der Tat ein Teil des Küchengebäudes den Ardusson, was ja einen gewissen funktionellen Sinn - direkten Zutritt zum Wasserlauf vom Inneren des Gebäudes - machte. Die zwei bereits vorgestellten Kupferstiche des Paraklet, die den letzten und vorletzten Status des Paraklet darstellen, unterstützen diese Deutung: Man erkennt ein jeweils deutlich vorspringendes Segment des Küchengebäudes.
Der relativ genaue Katasterplan, der ja nur noch aufgrund der im Boden verbliebenen Fundamentierung erstellt werden konnte, gibt lediglich die Grundrisse der historischen Klostergebäude (Konvent, Mühle, Gutshof) wieder, nicht jedoch die nach den Bilddarstellungen des 18. Jahrhunderts reichlich vorhandenen Zusatzgebäude - mit Ausnahme eines kleinen Gebäudes in Nordosten hinter den Konvent. Für die davor dargestellte und unharmonisch wirkende Verlängerung des Ostflügels nach Norden - mit einem Fragezeichen gekennzeichnet - gibt es aufgrund der sonstigen Quellen keine Evidenz; vielmehr floss hier der klosternahe Arm des Ardusson. Entweder wurde hier ein Brückenbauwerk oder ein rechts des Ardusson liegendes Gebäude messtechnisch miterfasst, oder es überspannte in der Tat ein Teil des Küchengebäudes den Ardusson, was ja einen gewissen funktionellen Sinn - direkten Zutritt zum Wasserlauf vom Inneren des Gebäudes - machte. Die zwei bereits vorgestellten Kupferstiche des Paraklet, die den letzten und vorletzten Status des Paraklet darstellen, unterstützen diese Deutung: Man erkennt ein jeweils deutlich vorspringendes Segment des Küchengebäudes.
Doch was hat es mit dem kleineren, rot eingekreisten, dahinter stehenden Gebäude auf sich? Möglicherweise handelte es sich hierbei um das Oratorium petit moustier. Diese Theorie wird durch zwei weitere Quellen gestützt:
 |
Schon René Louis vermutete, dass auf dem Stich von Picquenot an entsprechender Stelle das Oratorium abgebildet ist (René Louis, Pierre Abélard et l'architecture monastique: L'abbaye du Paraklet au diocèse de Troyes, 1951) |
 |
Die nahe Lage am Ardusson wurde auch durch ein Gemälde wiedergegeben, das der französische Landschaftsmaler Lazare Bruandet nach der Zerstörung der Kapelle angefertigt hatte. Es existiert ein farbkolorierter Kupferstich von Picquenot, der nach diesem Gemälde angefertigt wurde und das Oratorium in unmittelbarer Nähe zum Schilfgürtel des Ardusson zeigt. Das Motiv ist bei C. Charrier beschrieben. |
Ein anderer Entwurf von Bruandet zeigt uns die Ruinen von Abaelards Oratorium: Am Ufer des Ardusson, unter den Büscheln von Schilf, die von Wind und Wasser niedergedrückt werden, ein Stück alte Mauer in Form eines Dreiecks - zweigeteilt durch eine Art Pfeiler und unregelmäßig durchbrochen durch kleine Rundbogenfenster - ragt in den Himmel...
Charlotte Charrier, Heloïse dans l'histoire et dans la légende, Paris, 1933
 Bei aller künstlerischen Freiheit Picquenots - Lazare Bruandet, der die Vorlage lieferte, hatte den Paraklet relativ detailgetreu dargestellt. Beides ist aus anderer Darstellung bereits hinlänglich bekannt.
Bei aller künstlerischen Freiheit Picquenots - Lazare Bruandet, der die Vorlage lieferte, hatte den Paraklet relativ detailgetreu dargestellt. Beides ist aus anderer Darstellung bereits hinlänglich bekannt.
Demnach hätte Abaelards erstes Oratorium nordöstlich des Konventhauses, relativ nahe am Ardusson, gestanden. Leider lässt sich diese Hypothese ohne weitere Nachforschungen ebenfalls nicht verifizieren. Nach beendigung der Abbrucharbeiten blieb vom petit moustier keine Spur oberhalb des Geländeniveaus mehr übrig. Es existiert unseres Wissens auch kein Augenzeugenbericht. Allerdings zeigt eine Planskizze des Paraklet von 1867 an entsprechender Stelle noch eine halbkreisförmige bauliche Struktur, deren damalige Funktion noch nicht ermittelt werden konnte. Handelte es sich um eine Art Exedra? Sollte es sich um eine Baumaßnahme nach der Revolution gehandelt haben, müsste man annehmen, dass wegen des morastigen Geländes die Fundamentierungen des ehemaligen petit moustier benutzt worden sind (siehe Einkreisung links). Bei einer eigenen Inspektion waren im betreffenden Abschnitt des Parkareals keinerlei Bauteile oder Mauerreste mehr auszumachen.
Die Abteikirche
Der Schmuck des Gotteshauses soll das Notwendige, nicht das Überflüssige enthalten, mehr sauber als kostbar sein. Nichts in ihm soll aus Gold oder Silber gefertigt sein, außer ein silberner Kelch oder auch mehrere, wenn es nötig ist... Keine Bildhauerarbeiten sollen im Gotteshaus sein. Nur ein hölzernes Kreuz soll am Altar errichtet werden, worauf - nichts soll daran hindern - das Bild des Erlösers gemalt werden kann, wenn man will.
Abaelard, Brief 8, Regel für die Nonnen des Paraklet
Grab 1 und 2 im Chor der Priester, in Richtung den Heiligen Geist
Totenbuch des Paraklet
Auch wenn die Angaben Abaelards in der Historia Calamitatum es nicht expressis verbis wiedergeben, so ist es nicht ganz auszuschließen, dass Abaelards zweites, aus Steinen und Holz errichtetes Oratorium der Dreifaltigkeit, das er selbst Paraklet nannte, schon von Heloïsa in die neue, größere Abteikirche integriert worden war. In der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts umfasste der Konvent kurzfristig bis zu 60 Nonnen, die bei den Gottesdiensten alle im Chor der Kirche untergebracht werden mussten. Dies lässt ein wenig auf den Raumbedarf der damaligen Kirche rückschließen.
Um 1340 war eine erste Renovierung fällig. Im Jahre 1342 spendete die Königin Jeanne d'Evreux, die Gattin König Karls, eine beträchtliche Summe, unter anderem zur Ausstattung der Kirche:
Frau Königin Johanna von Evreux, einst Gattin des Königs Karl, König von Frankreich und Navarra, hat hier 60 Pfund gespendet... um... für die Reparatur, Unterhaltung und Restaurierung der hiesigen Kirche zu dienen... 1342
Totenbuch des Paraklet
...sie hat dieselben Gebeine begraben oder bestatten lassen, getrennt, an zwei Stellen des Chores der anfangs genannten Kirche des Paraklet, freilich die Gebeine des genannten Gründers an der rechten Seite und die Gebeine der verstorbenen ersten Äbtissin an der linken Seite, an der Stelle, wo man von besagtem Chor an den Hauptaltar derselben Kirche herantrat.
aus Charlotte Charrier, Heloïse dans l'histoire et dans la légende, Paris, 1933
 Die von Pajol gefundene Krypta lag ziemlich eindeutig außerhalb des Chores; sie ist mit der Begräbnisstätte von 1497 nicht identisch (siehe oben).
Die von Pajol gefundene Krypta lag ziemlich eindeutig außerhalb des Chores; sie ist mit der Begräbnisstätte von 1497 nicht identisch (siehe oben).
Über 100 Jahre ist dann der Überlieferungsfaden in Bezug auf die Abteikirche unterbrochen. Die Federzeichnung von 1548 ist nicht sehr realistisch. Sie zeigt eine stereotype, simplifizierte Darstellung der Gebäude - im Vergleich zum Nachbarort Saint-Aubin. Außerdem ist in keiner Weise die sich nördlich der Kirche anschließende Klosteranlage erkennbar. Vielmehr erscheint der unrealistisch in der gesamten Länge begradigte Ardusson direkt am Kirchbau vorbei zu fließen. Die Kirche ist als einfachen Längsbau, mit einem zentralen Glockenturm und spitzer Turmhaube, auf der der Wetterhahn thront, dargestellt. Die überlieferten Seitenportale sind nicht dargestellt. Immerhin ist die hohe Turmhaube überliefert. Sie soll zwölf Klafter hoch gewesen sein.
Falls die Kirche damals über ein Querschiff verfügt haben sollte, so war es sicher nur sehr kurz. Das große Gitter lag vor, nicht hinter der Zentralvierung und trennte den Nonnenchor mit der Dreifaltigkeitskapelle vom gemeinen Kirchenraum ab. Lage und Situation des im Totenbuch genannten cuer de prestres, d.h. Chor der Priester, ist unklar. Hier war die Begräbnisstätte mehrerer Äbtissinnen, außerdem der Beichtstuhl. Die anderen Äbtissinnen - außer Heloïse - waren im Nonnenchor begraben: en cuer. Dem Totenbuch der Abtei entnehmen wir weitere interessante Details: In der Kirche gab es - schon seit dem 14. Jahrhundert, im linken Seitenschiff, am Zugang zum Chor - auch eine chapelle de Nostre Dame, auch chapelle de la vierge genannt. Hier lag der Eingang zum Kloster: dou moustier: Vermutlich im rechten Seitenschiff existierte ein Portal und ein Altar des Heiligen Johannes: l'autel de saint Jehan enprès la darreniere tombe dever la porte und en dehors, nach draußen, an anderer Stelle. Die Kapelle des Heiligen Geistes ist im Totenbuch des Paraklet nur zweimal erwähnt, allerdings in Bezug auf sehr frühe Begräbnisse im 12. Jahrhundert: devers le Saint Esperit, Richtung Heiliger Geist. Später wird noch aufzuzeigen sein, dass die Kapelle in der Mitte der Abteikirche lag.
Die Verehrung der Kultstätte - der zweiten Grablegen von Heloïsa und Abaelard - überdauerte die Jahrhunderte. Folgende Quelle von 1616 weist deutlich darauf hin:
Man besucht heute beider gemeinsam geweihtes Grab im Oratorium des Paraklet, und feiert jährlich den Todestag mit einer Totenfeier, und zwar zur Erinnerung an den Meister am 21. April - er wurde 63 Jahre alt - und zur Erinnerung an die Äbtissin und frommsten Mutter am 16. Mai.
François Amboise, Apologetica Praefatio, 1616
Heute, am 15. März 1621, wurden die Leichname des Meisters Abaelard und Heloïsas überführt. Sie wurden jeweils von der rechten und von der linken Seite des großen Gitters herausgehoben, um in ein Beinhaus unter dem Hauptaltar überführt zu werden...
Totenbuch des Paraklet latin MS Troyes Bibl. Mun. 2450
Am 10. August 1650 verwüstete ein Wirbelsturm die Gebäude der Abtei. Der 12 Klafter hohe Glockenturm der Kirche stürzte herab und durchschlug das Dach der Kirche. Den überlieferten Urkunden nach musste in 60 Fuß Höhe der Wiederaufbau des Turmes bewerkstelligt werden: Y ayant 60 pieds de hault à travailler. Erwähnt wird die Zerstörung eines Uhrwerks am Giebel der Kirche und einer Kuppel: La piramide qui est sur le pignon de l'église et qui couvre l'orloge, et le dosme qui couvre un degré se sont aussi trouvé ruinés. Das Dach einer Kapelle, des Kreuzgangs und eines Pavillon wurden abgedeckt. Sur une chapelle et un pavillon la couverture a esté emportée. Das Mauerwerk des Kirchengiebels wurde beschädigt: La maçonnerie d'un pignon de l'église est ébranlée. Hier findet sich auch der einzige Hinweis darauf, dass das Kirchenschiff überwölbt war: Les voûtes mêmes ont été rompues. Die Krankenstation und die Apotheke, das Noviziat, die Bäckerei, schließlich die Wohnung der Äbtissin wurden beschädigt: Le noviciat, l'infirmerie, l'apotiquairie, la boulangerie, le logis de madame du Paraclit sont endommagés. Fast alle Bleiglasfenster wurden zerbrochen: Les vitres brisées montent à 1250 pieds de ver, estimés avec le plomb à sols le pied, ce qui reviendrait, a 500 livres. (Abbé Lalore, Cartulaire de l'abbaye du Paraclet, Paris, 1878) Gabrielle - Marie de La Rochefoucauld, 1639 - 1675, unternahm unter Aufnahme eines Kredits von 18000 Pfund die Restauration. (Roserot, Dictionnaire historique de la champagne méridionale, 1790). Es ist anzunehmen, dass beim Wiederaufbau der Klosterkirche auch das kurze Querschiff mit zwei weiteren Giebelfeldern errichtet und eventuell auch das Hauptschiff erweitert wurde. Das kurze Querschiff ist jedenfalls auf späteren Darstellungen zu erkennen (siehe unten).
1701 stellte die Äbtissin Catherine de La Rochfoucauld am Grabe Abaelards und Heloïsas eine eigenartige Statue auf, welche aus der Gründungszeit gestammt haben soll und die Heilige Dreifaltigkeit darstellte. Dom Martène und Dom Durand, zwei Benediktiner, besuchten 1717 den Paraklet und beschrieben die Statue:
Die Dreifaltigkeitsstaue bestand aus einem Block und man sah an ihr drei Personen in der Gestalt von drei Menschen mir gleicher Größe und Erscheinung - mit nur einem Unterschied, dass die mittlere auf dem Kopf eine Goldkrone trug mit der Inschrift: "Du bist mein Sohn", die zur Rechten auf dem Kopf eine Dornenkrone und in der Hand ein Kreuz mit der Inschrift: "Du bist mein Vater", und die zur Linken einen Blumenkranz mit den Worten: "Ich bin beider Odem"; während heute uns die Gemälde die Dreifaltigkeit in der Gestalt eines ehrwürdigen alten Mannes darstellen, der vor seinen Füßen ein Kreuz hat und aus dessen Mund eine Taube fliegt... Einige Leute von Geist haben diese Statue bemerkt und der Äbtissin geraten, sie von ihrem Aufstellungsort zu entfernen und an einem Platz aufzustellen, wo sie von all den Fremden gesehen werden könne, die zum Paraklet kämen, und die weder die Freiheit noch die Erlaubnis hätten, das Innere des Klosters zu betreten. Dies hatte sie einige Jahre zuvor ausgeführt und sie in den Nonnenchor transferieren lassen, nahe am Gitter, von wo man sie leicht betrachten konnte. Man hat unten eine Inschrift angebracht, die darauf hinzuweisen schien, dass man gleichzeitig die Überreste Abaelards und Heloïsas dorthin transferiert hätte, was zweifelsohne mit der Zeit mehrere Personen missverstanden; denn man hatte die beiden Leichname, die unter den Glocken in ihrem Gewölbe ruhten, überhaupt nicht berührt.
Voyage littéraire de deux religieux bénédictins, par Dom Martène et Dom Durand, 1717
Die Aussage "unter den Glocken" ist von Charrier bezüglich der Richtigkeit angezweifelt worden; sie ist jedoch korrekt. Wie Bilddarstellungen der Abteikirche auf alten Stichen belegen, war spätestens nach dem Wiederaufbau der Abteikirche der Glockenturm etwas hinter der Vierung - und somit über dem Chor - angebracht. Er stand damit in der Tat über der Krypta der Dreifaltigkeitskapelle.
 Ein
Gemälde von A. Lenoir, das gegen 1785 angefertigt wurde und sich heute im Besitz des Louvre befindet, zeigt die Trinitätsstatue - allerdings ohne Übereinstimmung mit obiger Beschreibung im Detail. Die Dreifaltigkeitstatue scheint an einer Seitenwand des Chores aufgestellt gewesen zu sein. Auf welcher Seite und in
welcher räumlichen Beziehung zum Altarraum, bleibt unklar. Der Ausführung nach handelt es sich mit Sicherheit um keine Skulpturengruppe aus dem 12. Jahrhundert, sondern aus viel späterer Zeit. Da Lenoir wohl kaum Zutritt zu betenden Nonnen gehabt haben dürfte, und seine Anwesenheit im Paraklet vor der
Zerstörung auch nicht bezeugt ist, stellt sich überhaupt die Frage der Wirklichkeitsgetreue. Vielleicht hat er sich lediglich später von den Angaben Martènes und Durands inspirieren lassen.
Ein
Gemälde von A. Lenoir, das gegen 1785 angefertigt wurde und sich heute im Besitz des Louvre befindet, zeigt die Trinitätsstatue - allerdings ohne Übereinstimmung mit obiger Beschreibung im Detail. Die Dreifaltigkeitstatue scheint an einer Seitenwand des Chores aufgestellt gewesen zu sein. Auf welcher Seite und in
welcher räumlichen Beziehung zum Altarraum, bleibt unklar. Der Ausführung nach handelt es sich mit Sicherheit um keine Skulpturengruppe aus dem 12. Jahrhundert, sondern aus viel späterer Zeit. Da Lenoir wohl kaum Zutritt zu betenden Nonnen gehabt haben dürfte, und seine Anwesenheit im Paraklet vor der
Zerstörung auch nicht bezeugt ist, stellt sich überhaupt die Frage der Wirklichkeitsgetreue. Vielleicht hat er sich lediglich später von den Angaben Martènes und Durands inspirieren lassen.
Zweifelsohne hatte Äbtissin Catherine de La Rochfoucauld die Absicht, die sterblichen Überreste des Paares zu heben und unter die Trinitätsstatue in einen Sarkophag zu verbringen, um ihre Verehrung zu erleichtern. Dies bezeugt folgende eingravierte Inschrift auf der Frontplatte - eine kurze Lebensbeschreibung von Abaelard. Sie ist auf Lenoirs Bild ebenfalls dargestellt und deutlich zu erkennen.
Par très haute et très puissante dame Catherine de La Rochefoucauld, abbesse, le 3 juin 1701.
Peter Abaelard, der Gründer dieser Abtei, lebte im 12. Jahrhundert. Er hob sich hervor durch die Tiefe seines Wissens und durch die Seltenheit seines Verdienstes. Indessen - er veröffentlichte eine Abhandlung über die Dreifaltigkeit, die durch ein Konzil - abgehalten in Soissons im Jahre 1120 - verurteilt wurde. Er zog sich sogleich in vollkommener Unterwerfung zurück. Um zu bezeugen, dass er nur orthodoxe Gedanken hegte, ließ er in diesem einzigen Stein diese drei Figuren schaffen, welche die drei göttlichen Personen in ein und demselben Wesen darstellen. Nachdem er diese Kirche dem Heiligen Geist geweiht hatte, nannte er sie Paraklet, in Zusammenhang mit den Tröstungen, die er an diesem Ort während seines Rückzugs aus der Welt erfahren hatte. Er war verheiratet mit Heloïse, die er zur ersten Äbtissin machte. Die Liebe, die ihren Geist lebenslang vereinte und die trotz ihrer Trennung durch zärtliche und höchst spirituelle Briefe bewahrt wurde, hat ihre Leichname in diesem Grab vereint. Er starb am 21. April im Jahre 1142, im Alter von 63 Jahren, nachdem sie sich gegenseitig die Zeichen eines christlichen und geistigen Lebens gegeben hatten.
Durch die sehr hoch stehende und sehr mächtige Dame Catherine de La Rochefoucauld, Äbtissin, am 3.Juni 1701.
Marie Charlotte de Roucy, die bereits erwähnte letzte Äbtissin des Paraklet, ergriff die Initiative, die sterblichen Überreste der Gründer erstmals in einen einzigen Sarg zu vereinen, nur durch eine Bleiplatte getrennt. Die Zeremonie spielte sich am 6. Juni 1780 ab. Die letzte Äbtissin erstellte höchstpersönlich das folgende Protokoll:
1ère Charlotte de Roucy -Abbesse.
Protokoll der Umbettung der Gebeine von Heloïse und Abaelard von der Krypta der Dreifaltigkeitskapelle zum Altar der Dreifaltigkeitskapelle in den Chor der Nonnen der königlichen Abtei des Paraclet: Am heutigen Tag, dem 6. Juni 1780, sind in der Gegenwart von uns, Charlotte de Roucy, Äbtissin der Königlichen Abtei des Paraclet, der frommen Schwestern und Gemeinschaft unserer genannten Abtei, von Pater Anselme, dem Kapuzinerbeichtvater, und von Herrn Antoine Vincent, Gemeindepfarrer von Quincey, aus ihren Steingräbern im Gewölbe der Kapelle der Dreifaltigkeit die Gebeine von Meister Peter Abaelard, Gründer, und von Heloïse, der ersten Äbtissin dieses Klosters, entnommen und überführt worden in zwei andere Gräber aus Blei, die zu Füßen des Altars der Hochheiligen Dreifaltigkeit im Chor der genannten frommen Damen platziert worden sind. Im Glauben daran, dass wir das vorliegende Protokoll unterzeichnet haben, um der Nachwelt alle folgenden Tage und Jahre als Zeugnis zu dienen.
Charlotte de Roucy, Äbtissin
Später wurde das Grab in den rückwärtigen Teil der Abteikirche platziert, schließlich hat es Madame de Roucy, die letzte Äbtissin, 1780 am Fuße der Dreifaltigkeitskapelle, die sich im Mittelpunkt der Kirche befand, unterbringen lassen...
Guide pittoresque du voyageur en France, Paris, 1838
Die Dreifaltigkeitstatue existierte bis zuletzt. Der Funktionär Lacoine, der die Auflösung des Konventes vollzog, hatte sie noch gesehen:
Il y avait, sur l'autel, au-dessus du tabernacle, un groupe de sculptures composé de trois statues sculptées d'une seule et même pierre par les ordres d'Abélard pour justifier son orthodoxie. Le groupe représentait les trois Personnes de la Sainte-Trinité.
Es gab über dem Altar, oberhalb des Tabernakel, eine Skulpturengruppe, die aus drei aus einem Stein gemeißelten Statuen bestand, entsprechend den Anordnungen Abaelards als Beweis seiner Orthodoxie. Die Gruppe stellte die drei Personen der Heiligen Dreifaltigkeit dar.
Lacoine, Brief an Baron Walckenaer, zitiert nach Albert Willocx, Abélard, Heloïse et le Paraclet, 1996
Diese Beschreibung widerspricht der oben gezeigten Darstellung Lenoirs, auf welcher ein Tabernakel oder Altartisch nicht zu erkennen ist. In wieweit die Dreifaltigkeitsstaue vorher nochmals Richtung Hauptaltar versetzt worden war, bleibt unklar. Erst nach der Umbettung der Leichname wurde diese Statue in Nogent-sur-Seine von marodierenden Revolutionären zerstört.
Dass unter dem Chor der Kirche eine weitläufige Krypta existiert hat, belegt Arbois de Jubainville, der nach der völligen Zerstörung der Abteikirche zwischen 1792 und 1794 um 1850 den Grundriss der Krypta erkundete und daraus die Dimensionen der Gesamtkirche erschloss:
2. un caveau situé autrefois sous la nef et divisé lui-même en deux nefs et quatre travées: long. 17 m 20, larg. 7 m 90, haut. 1 m 70. Trois piliers carrés ayant 1 m 10 de coté en plan, supportent une voûte d'arête.
Il semble résulter de là que l'église du Paraclet avait 24 m de long, y compris l'apside, et une largeur de 8 m.
1. Ein Tonnengewölbe, einst unter der Apsis gelegen, hat eine Länge von 6,30 m, eine Breite von 2,40 m, eine Höhe von 1,50 m. Dort ruhten einst die Leichname von Heloïse und Abaelard
2. Ein zweites Gewölbe verlängert das erste im Bereich des ehemaligen Hauptschiffes. Es ist in zwei Schiffe und vier Gewölbejoche aufgeteilt: Länge 17,20 m, Breite 7,90 m und Scheitelhöhe 1,70 m. Ein Kreuzgewölbe wird von drei (!) Vierkantpfeilern von 1,10 m Seitenlänge unterstützt.
Hieraus kann man die Dimensionen der Kirche ableiten, die einschließlich der Apsis 24 m lang und 8 m breit gewesen zu sein scheint.
Arbois de Jubainville: Répertoire archéologique du département de l'Aube, Paris, 1861
 Eine eigene Vermessung der Krypta im Herbst 2001 hat im Übrigen die Maße Jubainvilles annähernd bestätigen können: Es fand sich ein Raum von rechteckigem Grundriss und ca. 17,30 m Länge und 7,70 m Breite. Die Wände und Gewölbe sind aus groben Bruchsteinen gemauert und grob verputzt. Die Decke besteht aus zwei längs angeordneten und vier quer angeordneten Tonnengewölben von ca. 3,50 m Spannweite. Diese sind an beiden Querseiten so heruntergezogen, dass eine vermauerte Fortsetzung der Krypta nicht wahrscheinlich erscheint. Das
resultierende Kreuzgewölbe wird von drei 1 m langen und 0,80 m breiten Stützpfeilern getragen, die sich in Längsreihe in ca. 3,50 m Abstand befinden. Die Stärke der Außenmauern lässt sich an zwei künstlich geschaffenen Eingängen mit ca. 1,00 m Dicke nachvollziehen. Die Sohle ist durch Schwemmsand
aufgefüllt, eine Stichgrabung hat jedoch keine weiter Vertiefung des Niveaus verifizieren können. Die Scheitelhöhe der Gewölbe beträgt ca. 1,70m. Damit erscheint sicher, dass die Krypta schon zum Zeitpunkt der Anlage keinen aufrecht begehbaren Raum mit Eingangspforte darstellte und somit keinen kultischen
Zwecken - abgesehen von der Funktion als Grablege - diente. Die unter dem Obelisken befindliche Grablage - ein noch niedrigeres, quer angeordnetes Tonnengewölbe, von geringerer Spannweite - befindet sich in ca. 9,30 m
Entfernung im Osten der Krypta. Eine wie auch immer geartete Verbindung scheint nicht zu bestehen. wie die darin liegende Grabplatte ausweist, scheint es sich um ein isoliertes Grabgewölbe zu handeln.
Eine eigene Vermessung der Krypta im Herbst 2001 hat im Übrigen die Maße Jubainvilles annähernd bestätigen können: Es fand sich ein Raum von rechteckigem Grundriss und ca. 17,30 m Länge und 7,70 m Breite. Die Wände und Gewölbe sind aus groben Bruchsteinen gemauert und grob verputzt. Die Decke besteht aus zwei längs angeordneten und vier quer angeordneten Tonnengewölben von ca. 3,50 m Spannweite. Diese sind an beiden Querseiten so heruntergezogen, dass eine vermauerte Fortsetzung der Krypta nicht wahrscheinlich erscheint. Das
resultierende Kreuzgewölbe wird von drei 1 m langen und 0,80 m breiten Stützpfeilern getragen, die sich in Längsreihe in ca. 3,50 m Abstand befinden. Die Stärke der Außenmauern lässt sich an zwei künstlich geschaffenen Eingängen mit ca. 1,00 m Dicke nachvollziehen. Die Sohle ist durch Schwemmsand
aufgefüllt, eine Stichgrabung hat jedoch keine weiter Vertiefung des Niveaus verifizieren können. Die Scheitelhöhe der Gewölbe beträgt ca. 1,70m. Damit erscheint sicher, dass die Krypta schon zum Zeitpunkt der Anlage keinen aufrecht begehbaren Raum mit Eingangspforte darstellte und somit keinen kultischen
Zwecken - abgesehen von der Funktion als Grablege - diente. Die unter dem Obelisken befindliche Grablage - ein noch niedrigeres, quer angeordnetes Tonnengewölbe, von geringerer Spannweite - befindet sich in ca. 9,30 m
Entfernung im Osten der Krypta. Eine wie auch immer geartete Verbindung scheint nicht zu bestehen. wie die darin liegende Grabplatte ausweist, scheint es sich um ein isoliertes Grabgewölbe zu handeln.
Würde man - wie von Jubainville angegeben - beide Gewölbe auf Schiff und Chor der Abteikirche beziehen, ergäbe sich eine so kleine Abteikirche, dass die durch die bekannten Kupferstiche und eine Textstelle gegebene Firsthöhe von ca. 60 Fuß, d.h. ca. 20 Meter, in keiner Weise realistisch wäre. Außerdem wäre eine derart kleine Abteikirche so weit nach Osten zurückgesetzt, dass eine geschlossene Klosteranlage um den Kreuzgang herum nicht mehr nachzuvollziehen wäre. Eine Vermessung der Klosterfundamente im Jahre 1809 - also ca. 16 Jahre nach der Zerstörung der Abtei, aber noch vor einer Aufschüttung und neuerlichen Baumassnahmen - hatte ergeben, dass das Kirchenschiff einschließlich eines Vorbaus am Hauptportal doch erheblich größer gewesen sein muss, als von Jubainville angenommen: ca. 45 m lang! Dass der entsprechende Katasterplan wegen der absoluten Kongruenz mit einer aktuellen Luftaufnahme als sehr genau gelten muss, steht außer Frage. Die Widersprüche lassen sich dadurch erklären, dass sich Jubainville in der topographischen Zuordnung der Gewölbe geirrt hatte.
- Das von ihm einer vermeintlichen Apsis zugeschriebene Grabgewölbe liegt in Wirklichkeit etliche Meter hinter dem kurzen Chorschluss der Kirche und gehört damit überhaupt nicht zum Kirchenraum. Dies wurde bereits weiter oben näher beschrieben und begründet. Die Maße der Gruft korreliert im Übrigen in keiner Weise mit denen der Krypta.
- Eine Zuordnung der Krypta zum Hauptschiff ist ebenfalls nicht haltbar. Die Krypta lässt sich relativ eindeutig als Chorkrypta identifizieren, eventuell mit Einbeziehung der Vierung oder eines Teiles derselben. Wenn man nun auf die Große des Hauptschiffes extrapolierte und noch die Mauerstärken und den westlichen Portalvorbau der Kirche hinzu addierte, so erreicht die gesamte Kirche in der Tat ca. 50 m Länge. Allerdings scheint die Querausdehnung der Krypta nicht dem Querdurchmesser des Kirchen- und Chorraumes zu entsprechen. Auch die relativ geringe Stärke der Krypta-Außenmauern von 1 m spricht gegen eine tragende Funktion, was das gesamte Kirchenschiff betrifft.
Der letzten Äbtissin, Madame Charlotte de Roucy, war noch im Jahre 1780 auch eine Erneuerung des Pflasters und des großen Gitters der Kirche zu verdanken. Außerdem ließ sie eine weitere Grabinschrift in lateinischer Sprache anbringen, verfasst durch die "Académie des Inscriptions et Belles Lettres" im Jahre 1766:
Hier unter demselben Marmorstein ruhen Peter Abaelard, der Gründer dieses Klosters, und dessen erste Äbtissin, Heloïse, einstmals vereint durch die Erziehung, das Genie, die Liebe, eine unglückliche Heirat und die Reue; jetzt - so hoffen wir - vereint beide ein ewiges Glück. Peter verstarb am 21. April 1142, Heloïse am 17. Mai 1163. Auf Veranlassung von Charlotte de Roucy, Äbtissin des Paraclet, 1780.
Einfühlsame Seelen! Ehrt mit euren Tränen das Andenken an Heloïse und Abaelard; die Schönheit, der Geist und die Liebe hätten dieses Paar ein ganzes Leben lang glücklich machen sollen, sie waren es jedoch nur einen Augenblick.
Zitate aus: Charlotte Charrier, Heloïse dans l'histoire et dans la légende, Paris, 1933 und Albert Willocx, Abélard, Heloïse et le Paraclet, 1996
 Die ehemalige Abteikirche ist in ihrer Größe und äußeren Struktur auf dem Kupferstich um 1770 (veröffentlich in: "La Vallée et Brion, Voyage dans les départements de la France. -Département de l'Aube", Paris 1793, Seite 20) zu erkennen. Man beachte das hohe Hauptschiff und das gleichhohe, aber kurze Querschiff. Der Turmaufbau scheint nicht exakt auf der Vierung zu sitzen. Links des linken Seitenschiffs ist das Dach des Kapitelsaals gerade noch zu erkennen; er ist eventuell während der vorangegangenen Restauration um ein Stockwerk erhöht worden. Die Kirche zeigt im übrigen - wie deutlich zu erkennen ist -
die erwähnte Eingangshalle mit Pultdach.
Die ehemalige Abteikirche ist in ihrer Größe und äußeren Struktur auf dem Kupferstich um 1770 (veröffentlich in: "La Vallée et Brion, Voyage dans les départements de la France. -Département de l'Aube", Paris 1793, Seite 20) zu erkennen. Man beachte das hohe Hauptschiff und das gleichhohe, aber kurze Querschiff. Der Turmaufbau scheint nicht exakt auf der Vierung zu sitzen. Links des linken Seitenschiffs ist das Dach des Kapitelsaals gerade noch zu erkennen; er ist eventuell während der vorangegangenen Restauration um ein Stockwerk erhöht worden. Die Kirche zeigt im übrigen - wie deutlich zu erkennen ist -
die erwähnte Eingangshalle mit Pultdach.
 Der bereits gezeigte Kupferstich nach einem Motiv von Delaval, graviert von Baugean um 1795, also zur Zeit des Abbruchs der Abtei, gibt den traurigen Anblick des verbliebenen Westwerkes der bereits weitgehend zerstörten Abteikirche wieder. Man erkennt ein großes Rundportal, im Giebelfeld ein gotisches Fenster. Das Längsschiff ist bereits abgebrochen; man erkennt noch die dicken Mauerstümpfe und - rechts im Bild - die westliche Mauer des Kreuzgangs.
Der bereits gezeigte Kupferstich nach einem Motiv von Delaval, graviert von Baugean um 1795, also zur Zeit des Abbruchs der Abtei, gibt den traurigen Anblick des verbliebenen Westwerkes der bereits weitgehend zerstörten Abteikirche wieder. Man erkennt ein großes Rundportal, im Giebelfeld ein gotisches Fenster. Das Längsschiff ist bereits abgebrochen; man erkennt noch die dicken Mauerstümpfe und - rechts im Bild - die westliche Mauer des Kreuzgangs.
 Nach der Zerstörung in der französischen Revolution umgab die Familie Pajol Mitte des 19. Jahrhunderts den Grundriss der ehemaligen Abteikirche mit Sträuchern. Die heute begehbare Krypta ist im westlichen Abschnitt durch eine kleine Gedenkkapelle überbaut. Man erreicht die Kapelle durch eine enge Allee, die den vormaligen Platz der alten Abteikirche umgibt. Im Jahre 1868 hatte der damalige Besitzer, Baron Charles Walckenaer, eine Art Schutzdach über das vormalige Kirchenschiff der Klosterkirche errichtet. Zu Beginn des vorigen Jahrhunderts baute es sein Enkel Charles-Marie in eine Kapelle um. Dies muss vor 1914 stattgefunden haben, wie die vorhandenen Katasterpläne noch belegen. Er setzte dem Westgiebel einen kleinen Glockenturm auf, erweiterte den Ostgiebel zur Apsis, wo er einen Altar aufstellte. Dieses Bethaus wurde mit Sondererlaubnis des Vatikan geweiht und erhielt den Status einer halböffentlichen Kapelle, die vom Pfarrer von Quincey versehen wurde. Bis zum 2. Weltkrieg organisierte die Familie Walckenaer dort alljährlich eine feierliche Fronleichnamsprozession, die durch die Alleen des Besitzes in Begleitung der Mitglieder der Nachbarpfarreien zog. (nach Willocx).
Nach der Zerstörung in der französischen Revolution umgab die Familie Pajol Mitte des 19. Jahrhunderts den Grundriss der ehemaligen Abteikirche mit Sträuchern. Die heute begehbare Krypta ist im westlichen Abschnitt durch eine kleine Gedenkkapelle überbaut. Man erreicht die Kapelle durch eine enge Allee, die den vormaligen Platz der alten Abteikirche umgibt. Im Jahre 1868 hatte der damalige Besitzer, Baron Charles Walckenaer, eine Art Schutzdach über das vormalige Kirchenschiff der Klosterkirche errichtet. Zu Beginn des vorigen Jahrhunderts baute es sein Enkel Charles-Marie in eine Kapelle um. Dies muss vor 1914 stattgefunden haben, wie die vorhandenen Katasterpläne noch belegen. Er setzte dem Westgiebel einen kleinen Glockenturm auf, erweiterte den Ostgiebel zur Apsis, wo er einen Altar aufstellte. Dieses Bethaus wurde mit Sondererlaubnis des Vatikan geweiht und erhielt den Status einer halböffentlichen Kapelle, die vom Pfarrer von Quincey versehen wurde. Bis zum 2. Weltkrieg organisierte die Familie Walckenaer dort alljährlich eine feierliche Fronleichnamsprozession, die durch die Alleen des Besitzes in Begleitung der Mitglieder der Nachbarpfarreien zog. (nach Willocx).
Das Konventhaus
 Der
Wirbelsturm von 1650 hatte viele Gebäude der Abtei beschädigt, darunter auch die Wohnung der Äbtissin. Gabrielle-Marie de La Rochefoucauld, 1639 - 1675, begann die Restauration. Die hohen Kosten zwangen sie, die Summe von 18000 Pfund zu leihen. Nach ihrer Abdankung 1675 übernahm Catherine III de La Rochefoucauld die
weiteren Baumassnahmen. Sie errichtete 1686 ein neues Maison Abbatiale. Eine Schieferplatte am heutigen Gutshaus hoch über der Freitreppe trägt dieses Datum. Es hängt dort das Wappenschild der La Rochefoucauld, umgeben von der Kordel der Benediktiner, gekrönt von der Herzogskrone und von einem spiralig gewundenen Teil des Äbtissinnenstabes. Catherine III schied im Jahre 1706 aus dem Amt und starb im Jahre 1710.
Der
Wirbelsturm von 1650 hatte viele Gebäude der Abtei beschädigt, darunter auch die Wohnung der Äbtissin. Gabrielle-Marie de La Rochefoucauld, 1639 - 1675, begann die Restauration. Die hohen Kosten zwangen sie, die Summe von 18000 Pfund zu leihen. Nach ihrer Abdankung 1675 übernahm Catherine III de La Rochefoucauld die
weiteren Baumassnahmen. Sie errichtete 1686 ein neues Maison Abbatiale. Eine Schieferplatte am heutigen Gutshaus hoch über der Freitreppe trägt dieses Datum. Es hängt dort das Wappenschild der La Rochefoucauld, umgeben von der Kordel der Benediktiner, gekrönt von der Herzogskrone und von einem spiralig gewundenen Teil des Äbtissinnenstabes. Catherine III schied im Jahre 1706 aus dem Amt und starb im Jahre 1710.
![]() Der
Kupferstich von 1770 (veröffentlich in: "La Vallée et Brion, Voyage dans les départements de la France.
Département de l'Aube", Paris 1793, Seite 20), der wohl auf eine noch frühere
Vorlage zurückgeht, zeigt also noch den Vorgängerbau von 1686. Dies belegt ein kleines Detail des Stiches. Es wurde damals eine Baumallee zum Konvent hin bepflanzt. Diese Allee ist auf dem Katasterplan von 1708 bereits zu erkennen, kommt allerdings auf dem Stich von 1770 nicht zur Darstellung. Dies spricht sehr für die frühere Datierung! Das Konventsgebäude bestand im Gegensatz zum heutigen Gutshaus aus einem West- und Nordflügel mit jeweils 2 Fensterreihen zu je 6 Fenstern. Das Längsgebäude ist deutlich höher als das Quergebäude; beide Baukörper sind etwas zueinander versetzt. Man beachte die hübschen Dachgauben!
Der
Kupferstich von 1770 (veröffentlich in: "La Vallée et Brion, Voyage dans les départements de la France.
Département de l'Aube", Paris 1793, Seite 20), der wohl auf eine noch frühere
Vorlage zurückgeht, zeigt also noch den Vorgängerbau von 1686. Dies belegt ein kleines Detail des Stiches. Es wurde damals eine Baumallee zum Konvent hin bepflanzt. Diese Allee ist auf dem Katasterplan von 1708 bereits zu erkennen, kommt allerdings auf dem Stich von 1770 nicht zur Darstellung. Dies spricht sehr für die frühere Datierung! Das Konventsgebäude bestand im Gegensatz zum heutigen Gutshaus aus einem West- und Nordflügel mit jeweils 2 Fensterreihen zu je 6 Fenstern. Das Längsgebäude ist deutlich höher als das Quergebäude; beide Baukörper sind etwas zueinander versetzt. Man beachte die hübschen Dachgauben!
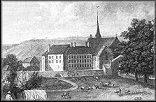 Unter Marie IV. de Roye de la Rochefoucault de Roucy werden die Konventsgebäude etwas verändert worden sein. Näheres ist nicht überliefert.
Allerdings ergeben sich indirekte Hinweise auf diesen Vorgang, zum Beispiel eine ungedeckte Summe aus den Verkauf von Nutzholz. Die letzte bauliche Erweiterung der Konventgebäude fällt in die Jahre um 1780. Marie Charlotte de Roucy, die 29. und letzte Äbtissin, regierte in den Jahren 1778 bis 1792. In dieser Zeit erfuhr der Paraklet eine bislang nicht gekannte Beliebtheit. Ein Besucher folgte auf dem anderen, angespornt durch die sentimental geprägte Literatur. Auch diese Äbtissin markierte ihre Herrschaft mit bedeutenden Arbeiten, errichtete einen neuen und weitläufigen Gebäudekomplex von 126 Fuß Länge - gemeint ist der neue Nordflügel -, rekonstruierte den Kapitelsaal, erneuerte das Pflaster der Kirche, verschloss den Chor mit einem schönen Ziergitter und reorganisierte die Bibliothek (Roserot, Dictionnaire historique de la champagne méridionale, 1790). Den entsprechenden Anblick zeigt ein Kupferstich, der nach der Zerstörung der Abtei von Picquenot angefertigt wurde, jedoch den baulichen Zustand um 1790 wiedergibt,
wenn gleich auch mit Realitätsabweichungen.
Unter Marie IV. de Roye de la Rochefoucault de Roucy werden die Konventsgebäude etwas verändert worden sein. Näheres ist nicht überliefert.
Allerdings ergeben sich indirekte Hinweise auf diesen Vorgang, zum Beispiel eine ungedeckte Summe aus den Verkauf von Nutzholz. Die letzte bauliche Erweiterung der Konventgebäude fällt in die Jahre um 1780. Marie Charlotte de Roucy, die 29. und letzte Äbtissin, regierte in den Jahren 1778 bis 1792. In dieser Zeit erfuhr der Paraklet eine bislang nicht gekannte Beliebtheit. Ein Besucher folgte auf dem anderen, angespornt durch die sentimental geprägte Literatur. Auch diese Äbtissin markierte ihre Herrschaft mit bedeutenden Arbeiten, errichtete einen neuen und weitläufigen Gebäudekomplex von 126 Fuß Länge - gemeint ist der neue Nordflügel -, rekonstruierte den Kapitelsaal, erneuerte das Pflaster der Kirche, verschloss den Chor mit einem schönen Ziergitter und reorganisierte die Bibliothek (Roserot, Dictionnaire historique de la champagne méridionale, 1790). Den entsprechenden Anblick zeigt ein Kupferstich, der nach der Zerstörung der Abtei von Picquenot angefertigt wurde, jedoch den baulichen Zustand um 1790 wiedergibt,
wenn gleich auch mit Realitätsabweichungen.
 Man erkennt die Gliederung des Westflügels mit 3 x 9 Fenstern sowie des Nordflügels mit jeweils 4 Fenstern in den oberen Stockwerken. Bei der Darstellung der Dreistöckigkeit könnte sich der Künstler allerdings falsch erinnert haben; ansonsten wäre der Vorgängerbau wesentlich höher als das heutige Gebäude gewesen. Neu ist auch ein großer Vorbau, der sich zur Rechten an das Konventgebäude anschloss. Er soll sich stilistisch an das Ancien Hôtel Jodrillat in Sens, das aus derselben Zeit stammt, angelehnt haben. Über seinen eigentlichen Zweck ist nichts bekannt. Vermutlich war es ein Torbau. Diesen Eindruck bekommt man durch Betrachtung des Stiches nach dem Entwurf von Delaval, der dasselbe Gebäude rechts hinter der Abteikirche zeigt. Der Westgiebel dieses Gebäudes wäre demnach bereits abgebrochen gewesen, während der Südgiebel des Äbtissinnenhauses noch stand.
Man erkennt die Gliederung des Westflügels mit 3 x 9 Fenstern sowie des Nordflügels mit jeweils 4 Fenstern in den oberen Stockwerken. Bei der Darstellung der Dreistöckigkeit könnte sich der Künstler allerdings falsch erinnert haben; ansonsten wäre der Vorgängerbau wesentlich höher als das heutige Gebäude gewesen. Neu ist auch ein großer Vorbau, der sich zur Rechten an das Konventgebäude anschloss. Er soll sich stilistisch an das Ancien Hôtel Jodrillat in Sens, das aus derselben Zeit stammt, angelehnt haben. Über seinen eigentlichen Zweck ist nichts bekannt. Vermutlich war es ein Torbau. Diesen Eindruck bekommt man durch Betrachtung des Stiches nach dem Entwurf von Delaval, der dasselbe Gebäude rechts hinter der Abteikirche zeigt. Der Westgiebel dieses Gebäudes wäre demnach bereits abgebrochen gewesen, während der Südgiebel des Äbtissinnenhauses noch stand.
Näheres zu den abgebildeten Kupferstichen findet sich auch unter: Kupferstiche des Paraklet aus dem 18. Jahrhundert
Über das Innere der Konventgebäude gibt es so gut wie keine Nachricht. Lediglich der Engländer Crawfurd erzählte vom Bericht eines Freundes, welcher das Kloster kurz vor der Zerstörung besucht hatte:
Als ich in Begleitung der Äbtissin in das Sprechzimmer und den Salon trat, fiel der Blick sofort auf mehrere Portraits von Abaelard und Heloïse. Sie hat solche sogar auf ihrer Tabaksdose, auf allen Möbelstücken ihres Appartements, selbst am Kopfende ihres Bettes. Ich betrat auch mehrere Zellen der Nonnen, wo dieselben Portraits unter den Kruzifixen und Reliquien hervorstachen. Der Paraklet ist - wie ich glaube - auf der ganzen Welt der einzige Konvent, wo die Freuden und Unglücksfälle der zwei Liebenden andauernd Gegenstand von Überlegungen und Diskussionen war.
Crawfurd, Mélanges d'Histoire et de Littérature tirés d'un portefeuille, 1809
Am 21. Juli 1794 wurden der Schauspieler Boutet de Monvel, Direktor des Republiktheaters, und seine Gattin Eigentümer des Äbtissinnenhauses, welches von den Zerstörern stehen gelassen worden war, und richteten dieses als Wohnhaus ein...
Albert Willocx, Abélard, Heloïse et le Paraclet, 1996
Thévenot, der Hausverwalter des Pfarrers von Nogent-sur-Seine, verschaffte sich das Ensemble für die Summe von 78000 Francs. Der neue Eigentümer beschäftigte sich wenig mit seinem Eigentum und überließ es dem Notar Hayaux. Dieser ging den Abbruch der Gebäude an, wobei er mit der Kirche begann. Sein Nachfolger, der Pariser Trödler Joseph Simon, setzte das Zerstörungswerk fort...
Albert Willocx, Abélard, Heloïse et le Paraclet, 1996
Diese Abtei bot nur noch Ruinen, als sie das Eigentum von General Pajol wurde, der mit den Trümmern auf den alten Fundamenten ein ebenmäßiges, schön anzuschauendes Gebäude errichten ließ.
Guide pittoresque du voyageur en France, Paris, 1838
Dieser Flügel stammt von einer Vorgängerkonstruktion aus dem 17. Jahrhundert und enthält im Erdgeschoss die alten Küchengewölbe des Klosters mit ihrem Innenbrunnen, der sogar auf die Frühzeit der Abtei zurückreichen könnte. Als Baron Walckenaer im Jahre 1835 das Anwesen kaufte, war dieser Trakt noch um ein weiteres Gebäude verlängert, wo sich im Erdgeschoss das Refektorium der Nonnen und im ersten Stock die 24 Zellen befanden. Der Baron ließ das vom Verfall bedrohte Gebäude abreißen.
Albert Willocx, Abélard, Heloïse et le Paraclet, 1996
 Demnach ist der weitaus größere Teil des heutigen Gutshauses - der Westflügel - erst um 1830 von Graf Pajol auf den alten Fundamenten neu errichtet worden. Die Schieferplatte mit dem Wappen der Äbtissin, der Familie La Rochfoucauld, von 1686, wurde damals lediglich als Erinnerungsstück in den Neubau integriert. Dieses noch heute stehende Gutshaus ist ein symmetrisch angelegtes, zweistöckiges, herrschaftliches Quergebäude im klassizistischen Stil - mit 9 großen Fenstern im Obergeschoss und 3 Flügeltüren im Untergeschoss, zur Seite jeweils flankiert von 3 großen Fenstern. Fenster und Türen tragen breite Ziegel-Lisenen. Die Baulinie dieses Gebäudes verläuft nicht parallel zur Einfriedung. Es steht nach rechts etwas zurückgesetzt. Vor den Türen findet sich eine große Freitreppe. Zur Linken schließt sich - aus dem Bild nicht zu erkennen - der im rechten Winkel errichtete und nach Osten sich erstreckende Längsbau an. Die heutigen Dimensionen des Gebäudes belegen den Unterschied zur Größe von 1809, die dem existierenden Katasterplan entnommen werden kann. Nordflügel
23,75x10 qm (vormals ca. 45x12,50qm) und Westflügel 32,5x8,75 qm (vormals ca. 36,5x10
qm). Der Unterschied der Dimensionen beseitigt den letzten Zweifel an der Neukonstruktion im 19. Jahrhundert.
Demnach ist der weitaus größere Teil des heutigen Gutshauses - der Westflügel - erst um 1830 von Graf Pajol auf den alten Fundamenten neu errichtet worden. Die Schieferplatte mit dem Wappen der Äbtissin, der Familie La Rochfoucauld, von 1686, wurde damals lediglich als Erinnerungsstück in den Neubau integriert. Dieses noch heute stehende Gutshaus ist ein symmetrisch angelegtes, zweistöckiges, herrschaftliches Quergebäude im klassizistischen Stil - mit 9 großen Fenstern im Obergeschoss und 3 Flügeltüren im Untergeschoss, zur Seite jeweils flankiert von 3 großen Fenstern. Fenster und Türen tragen breite Ziegel-Lisenen. Die Baulinie dieses Gebäudes verläuft nicht parallel zur Einfriedung. Es steht nach rechts etwas zurückgesetzt. Vor den Türen findet sich eine große Freitreppe. Zur Linken schließt sich - aus dem Bild nicht zu erkennen - der im rechten Winkel errichtete und nach Osten sich erstreckende Längsbau an. Die heutigen Dimensionen des Gebäudes belegen den Unterschied zur Größe von 1809, die dem existierenden Katasterplan entnommen werden kann. Nordflügel
23,75x10 qm (vormals ca. 45x12,50qm) und Westflügel 32,5x8,75 qm (vormals ca. 36,5x10
qm). Der Unterschied der Dimensionen beseitigt den letzten Zweifel an der Neukonstruktion im 19. Jahrhundert.
Die sonstigen Gebäude des inneren Klosterbezirks
Die alte Kirche, der Kreuzgang, der Saal mit dem Namen "Das Kapitel" und ein Schlafsaal, alles von Heloïse errichtete Gebäude, standen noch, mit ihren Täfelungen, denen ähnlich, die Sie aus alten gotischen Gebäuden kennen.
Crawfurd, Mélanges d'Histoire et de Littérature tirés d'un portefeuille, 1809
Für das Jahr 1519 ist eine Renovierung durch die Äbtissin Catherine de Courcelles im Totenbuch erwähnt:
Sie errichtete den Kreuzgang, das Refektorium und andere mit ihrem Wappen gekennzeichneten Gebäude.
Totenbuch des Paraklet
Viele bauliche Details der Abteigebäude entnimmt man dem Totenbuch des Paraklet, einige den bekannten Bilddarstellungen:
- Der frühgotische Kapitelsaal lag mit großer Sicherheit im Anschluss an Kreuzgang und rechtem Seitenschiff. Er muss ebenerdig gewesen sein, da er mehrere Grablegen enthielt. Die Rede ist unter anderem von einem großen Grab, ou milieu dou chapistre souz la grant tombe, von einem Grabgitter, delez le postel à destre à la tombe qui est fendue. Er hatte mehrere Säulen sowie 11 Fenster: ou milieu des 11 fenstre dever le paver (14. Jahrhundert). Vermutlich waren es 12 Fenster, entsprechend der Zahl der Apostel, denn an anderer Stelle ist von 11 Pfeilern die Rede: entre les 11 postiaus. Möglicherweise öffnete sich so der Kapitelsaal in breiter Front zum Kreuzgang. Er enthielt den Äbtissinnenstuhl la chaiere und einen linken und rechten Chor: devers le destre cuer endroit le gros postel. Auf der Seite des linken Chores saß die Priorin: en chapitre à senestre cuer endroit la prieuse.
- Der Kreuzgang bildete das
geometrische Zentrum der Abtei. Der östliche Bereich stammte aus frühester Zeit.
Hier lagen - wie in der Abteikirche, in der Kapelle petit moustier, im Kapitelsaal und im Friedhof - zahlreiche Grabstellen von Nonnen und anderen, mit dem Kloster assoziierten Persönlichkeiten. Das Totenbuch berichtet von Einzelheiten: Offensichtlich gab es im Osten des Gevierts neben den erwähnten 11 Pfeilern zum Kapitelsaal auch noch einen großen Bogen: devers le prael de 11 qui sont ensemble delez l'archet.
 Dieser Bogen ist schon für das Jahr 1197 belegt:
en cloitre devant l'archet. Vermutlich enthielt der Bogen ein Kruzifix:
en cloistre aus piez dou crucefi, dessen Verehrung auf Abaelard selbst zurückging. Zumindest findet sich im Totenbuch ein Eintrag aus dem 16. Jahrhundert, dass dort in Erinnerung an die Äbtissin Helie Dame de Villemaur (Melisande ?) um 1197 ein Antiphon Parce und der Gesang Regem, le responz du Mestre, das Responsorium des Meisters, gesungen wurden. Um 1770 stand an der Südostecke des Kreuzgangs,
an der Kapitelfront in der Nähe zum Kircheneingang, eine Statue des Heiligen
Benedikt: dedans le chapitre au droit saint Benoist en deca du pillier
und dans le cloitre tout proche les marches (Stufen) de la grand porte de l'eglise du coté de notre pere saint Benoist. Nach Westen gab es anfangs wohl nur eine Mauer mit dem großen Tor:
à la porte de cloistre, ou pan dever l'us de claustre. Vermutlich wurde diese Seite auch als niedere Seite bezeichnet: au bas coté du cloitre. Ob der erwähnte Ausgang mit dem Eingang zum Kloster identisch war, muss offen gelassen werden; dieser lag am ehesten in der Nordwestecke:
à la porte dou moustier ou quoignet, ou moustier devers le mur,
le gros postel si com en entre ou moustier. Für das Jahr 1650 ist eine
kleine Pforte in den Nonnenchor erwähnt. Sie lag vermutlich in der Südostecke:
proche la petit porte du choeur des dames. Die Südwestecke ist ebenfalls
beschrieben: devant la porte de l'eglise dedans le cloitre. Es gab Rosenbeete:
les rosiers delez le gros potel. Hier stand eine Statue des heiligen
Thomas: ou grant cloistre desouz saint Thomas. Im 16. Jahrhundert ist
eine Statue des Barmherzigen Madonna erwähnt: devant NotreDame de Pitié au cloitre,
im 18. Jahrhundert eine des Heiligen Claudius: dans le cloitre aux pieds de saint Claude.
Dieser Bogen ist schon für das Jahr 1197 belegt:
en cloitre devant l'archet. Vermutlich enthielt der Bogen ein Kruzifix:
en cloistre aus piez dou crucefi, dessen Verehrung auf Abaelard selbst zurückging. Zumindest findet sich im Totenbuch ein Eintrag aus dem 16. Jahrhundert, dass dort in Erinnerung an die Äbtissin Helie Dame de Villemaur (Melisande ?) um 1197 ein Antiphon Parce und der Gesang Regem, le responz du Mestre, das Responsorium des Meisters, gesungen wurden. Um 1770 stand an der Südostecke des Kreuzgangs,
an der Kapitelfront in der Nähe zum Kircheneingang, eine Statue des Heiligen
Benedikt: dedans le chapitre au droit saint Benoist en deca du pillier
und dans le cloitre tout proche les marches (Stufen) de la grand porte de l'eglise du coté de notre pere saint Benoist. Nach Westen gab es anfangs wohl nur eine Mauer mit dem großen Tor:
à la porte de cloistre, ou pan dever l'us de claustre. Vermutlich wurde diese Seite auch als niedere Seite bezeichnet: au bas coté du cloitre. Ob der erwähnte Ausgang mit dem Eingang zum Kloster identisch war, muss offen gelassen werden; dieser lag am ehesten in der Nordwestecke:
à la porte dou moustier ou quoignet, ou moustier devers le mur,
le gros postel si com en entre ou moustier. Für das Jahr 1650 ist eine
kleine Pforte in den Nonnenchor erwähnt. Sie lag vermutlich in der Südostecke:
proche la petit porte du choeur des dames. Die Südwestecke ist ebenfalls
beschrieben: devant la porte de l'eglise dedans le cloitre. Es gab Rosenbeete:
les rosiers delez le gros potel. Hier stand eine Statue des heiligen
Thomas: ou grant cloistre desouz saint Thomas. Im 16. Jahrhundert ist
eine Statue des Barmherzigen Madonna erwähnt: devant NotreDame de Pitié au cloitre,
im 18. Jahrhundert eine des Heiligen Claudius: dans le cloitre aux pieds de saint Claude.
- Dem Kapitelsaal schloss sich das Refektorium an: dans le chapitre devant la fenêtre du cloître du coté du réfectoire.
- Im Nordflügel lag die Küche, die vom Kreuzgang aus betreten werden konnte: ou pan du clastre devers la cuisine.
- Das Obituarium erwähnt außerdem einen kleinen Saal: souz la goutiere delez la petite sale. Dessen Lage und Funktion bleiben unklar.
- Die Angabe eines neuen Hauses: delez la maison nueve bezieht sich wohl auf das Konventgebäude (Renovierung von 1686?)
- Der Klosterschatz war im Bereich der Abteikirche, vermutlich der Sakristei, untergebracht. Das Totenbuch nennt: Joanna de Vitri, thesauraria, obiit 1484 und Marguarita de La Chastre, tresoriaria de paracleto (1588). Schon Abaelard hatte in seinem Regelentwurf das Amt eine sacrifica oder thesauraria, d.h. Meßnerin oder Schatzwärterin, vorgesehen.
Über die Lage und Größe der Bibliothek, die sich normalerweise dem Kapitelsaal anschließt, wissen wir nichts Genaues - ebensowenig über die Existenz eines Skriptoriums.
- Der Kupferstich des Klosters um 1770 zeigt noch links neben der Kirche, vor dem Kreuzgang, ein weiteres schmales Gebäude. Seine Funktion ist ebenfalls unbekannt. Allerdings fällt eine Analogie zur zeitgenössischen Abtei Thiron auf. Diese beherbergte in einem entsprechenden Gebäude den Prior. Handelte es sich somit um das Haus der ersten Priorin?
- Bei den Zerstörungen durch den Wirbelsturm von 1650 wurden u.a. die Krankenstation und die Apotheke - l'apotiquairie -, das Noviziat und die Bäckerei beschädigt. Wo diese Gebäude lagen, ist nicht genau bekannt: Möglicherweise sind sie zum Teil auf dem Stich nach einem Motiv von Delaval, aus der Zeit des Abbruchs, abgebildet. Er zeigt weitere Gebäude im Nordosten der Abtei, die wenig Ähnlichkeit mit frühmittelalterlichen Gebäudeteilen aufweisen. In die Jahre nach 1759 fiel die Errichtung einer neuen Infirmerie. Am 12. Februar 1759 besichtigte der Architecte da la maîtrise des Eaux et Forêts de Champagne, Jean-Baptiste-Alexandre Musson, den Paraklet und schlug die Errichtung dieses Gebäudes, das wahrscheinlich im Osten, hinter den Konventgebäuden, lag, und die Renovierung einer Scheune im Basse Cour zum Preis von 15 700 Livres vor. Da die Äbtissin von einer sofortigen Umsetzung der Pläne jedoch abgesehen hatte, steht der genaue Zeitpunkt der Errichtung der Krankenstation nicht fest. Gesichert ist ihre Existenz erst 1786.
Die Klostermauern
 Es ist anzunehmen, dass das Kloster schon
von Beginn an über eine Klostermauer verfügte. Im Jahre 1509 kann sie den Ansprüchen nicht mehr genügt haben, denn Bischof Jacques Ranguier von Troyes ließ nach zweifelhaften Gerüchten das Kloster unter Catherine von Courcelles reformieren und mit neuen Mauern und Gittern umgeben (Totenbuch des Paraklet). Die Federzeichnung von 1548 zeigt diese Mauern. Der Kupferstich aus der Zeit um 1686 gibt als Detail das Abteitor mit dem Häuschen der Pförtnerin wieder. Schon Abaelard hatte hierzu in seinem Regelentwurf für die Nonnen des Paraklet eigene Vorstellungen über die Funktion der Klosterpforte entwickelt:
Es ist anzunehmen, dass das Kloster schon
von Beginn an über eine Klostermauer verfügte. Im Jahre 1509 kann sie den Ansprüchen nicht mehr genügt haben, denn Bischof Jacques Ranguier von Troyes ließ nach zweifelhaften Gerüchten das Kloster unter Catherine von Courcelles reformieren und mit neuen Mauern und Gittern umgeben (Totenbuch des Paraklet). Die Federzeichnung von 1548 zeigt diese Mauern. Der Kupferstich aus der Zeit um 1686 gibt als Detail das Abteitor mit dem Häuschen der Pförtnerin wieder. Schon Abaelard hatte hierzu in seinem Regelentwurf für die Nonnen des Paraklet eigene Vorstellungen über die Funktion der Klosterpforte entwickelt:
Die Pförtnerin soll ihre Häuschen neben der Eingangstür haben, woselbst sie oder ihre Stellvertreterin allezeit der Ankommenden gewärtig sein soll... Sobald ans Tor geklopft oder draußen gerufen wird, soll die Diensthabende die Ankömmlinge fragen, wer sie sind oder was sie wollen, und wenn es nötig ist, die Pforte öffnen und die Ankommenden hereinlassen. Allerdings dürfen nur Frauen im Inneren bewirtet werden...
Abaelard, Brief 8, Regel für die Nonnen des Paraklet
 Später wurde der Torbau etwas repräsentativer gestaltet. Doch auch danach war das Abteitor an der Westfront des Klosters nicht sehr groß; es konnte allenfalls mit einem kleinen Pferdegespann passiert werden. Dies bestätigt folgende Passage des Herrn Lacoine, der die Auflösung des Konventes im Jahre 1792 vollzogen hatte. Es existiert eine Darstellung des Torbaus aus der Zeit des großen Abbruchs - ein Aquarell um 1809.
Nebenbei erkennt man die Türme des Gutshofes. Man beachte den dritten Rundturm im Hintergrund. Er ist heute nicht mehr erhalten.
Später wurde der Torbau etwas repräsentativer gestaltet. Doch auch danach war das Abteitor an der Westfront des Klosters nicht sehr groß; es konnte allenfalls mit einem kleinen Pferdegespann passiert werden. Dies bestätigt folgende Passage des Herrn Lacoine, der die Auflösung des Konventes im Jahre 1792 vollzogen hatte. Es existiert eine Darstellung des Torbaus aus der Zeit des großen Abbruchs - ein Aquarell um 1809.
Nebenbei erkennt man die Türme des Gutshofes. Man beachte den dritten Rundturm im Hintergrund. Er ist heute nicht mehr erhalten.
Ihr schmaler Wagen, vor den zwei schlechte Gäule gespannt waren, kam am Tor der Vorhalle an. Das war das Zeichen zu Abreise...
Lacoine, Brief an Baron Walckenaer, zitiert nach Albert Willocx, Abélard, Heloïse et le Paraclet, 1996
Da unwahrscheinlich ist, dass hier ein größeres Fuhrwerk passieren konnte, andererseits die Wirtschaftsgebäude hinter dem Konvent auch Transporte mit schweren Lasten erreichen mussten, liegt der Schluss nahe, dass auch im Osten der Abtei ein Zufahrtstor lag. Der Stich nach Delaval zeigt aus entsprechender Richtung einen Zufahrtsweg. Ob dieser allerdings erst im Rahmen der Abbrucharbeiten angelegt wurde, bleibt offen.
Das Kreuz des Meisters
Nur ein Kreuz soll am Altar aufgestellt werden, gegebenenfalls mit dem Bild des Erlösers...
Abaelard, Brief 8, Regel für die Nonnen des Paraklet
Dieses Kreuz des Meisters kann mit einem entsprechenden Kreuz im Kreuzgang, das schon oben erwähnt wurde, nicht identisch gewesen sein. Dasselbe gilt für die Wegkreuze, die die Federzeichnung des Paraklet von 1548 und der Katasterplan von 1708 - an nicht identischer Stelle - zeigen: jeweils ein Straßenkreuz an der schon oben erwähnten Höhenstrasse nördlich des Paraklet.
Nach Corrard de Breban war das Kreuz des Meisters einst im südlichen Eck eines Hages von 13 Morgen, inmitten der Abtei, gelegen (aus Charlotte Charrier, Heloïse dans l'histoire et dans la légende, Paris, 1933). Es ist heute nicht mehr möglich, den Ort des Kreuzes genau zu lokalisieren. Sicherlich lag es außerhalb des für die Öffentlichkeit gesperrten inneren Klosterbezirkes, vermutlich nördlich des Ardusson, am Rande eines Wäldchens in der Nordwest- oder Nordostecke der Klosterareals - dem späteren Garten Le Roucy.
Dorthin zogen die Nonnen mit den Einwohnern der umliegenden Dörfer, hielten einen Wortgottesdienst ab, anschließend tanzten sie zusammen mit der Gemeinde und sangen Lieder. Am 4. August 1499 nahm Bischof Jacques Raguier an dieser seiner Meinung nach skandalösen Praxis Anstoß. Die Nonnen protestierten und beriefen sich auf einen alten Brauch und Zehnt-Rechte in den betreffenden Gemeinden. Der Bischof ordnete daraufhin eine Überprüfung an. Wie die Sache ausgegangen ist, ist unbekannt.
Ähnliche Tanzfeste waren auch von anderen Frauenklöstern des XII. Jahrhunderts bekannt (Delisle, Le clérgé normand du XIIieme siècle, 1846).
Die beschriebene Zeremonie erinnert stark an den Hymnus Epithalamica von Peter Abaelard, ein mystischer Gesang, der zu Lebensfreude, Tanz und Gesang aufforderte:
Ihr jungen Mädchen, führt den Reigen, und stimmet ein in den Gesang, den sie begann. Die Freunde des Bräutigams haben euch zum Hochzeitsfest geladen, und ein Lied von der neuen Herrin wünschen wir!
Abaelard, Hymnus Epithalamica
Der Nonnenfriedhof
... wollen wir für Eure Anstrengungen vorsorgen und gewähren Euch und Euren Nachfolgerinnen durch die apostolische Autorität die freie Verfügung, Eure Brüder, die besitzlos sind, bei Eurer Abtei zu bestatten...
Urkunde des Papstes Hadrian IV an Heloïsa vom 13. Februar 1156
auctoritate vobis Apostolica concedimus, ut eos, qui de facultatibus suis ecclesie vestre grata conferunt solatia charitatis, si forte non proprio reatu, sed pro alienis sunt excessibus interdicti, liceat vobis ad sepulturam recipere, et ipsos in cemeterio vestro cum aliis fidelibus tumulare
So erlauben wir Euch mit der apostolischen Autorität, dass ihr diejenigen, die nach ihren Möglichkeiten Eurer Kirche die Trostspenden der Nächstenliebe gebracht haben - falls sie nicht aus eigener Anklage, sondern wegen fremder Ausschreitungen mit Interdikt belegt sind - zum Begräbnis aufnehmen und sie mit den anderen Gläubigen zusammen in Eurem Friedhof bestatten dürft.
Urkunde des Papstes Hadrian IV an Heloïsa vom 25. November 1156
... sepulturam ... liberam esse decernimus... qui se illic sepeliri deliberaverunt, nisi forte excommunicati aut interdicti sunt...
... haben wir beschlossen, dass die Bestattung all denen frei sei... die dort bestattet werden wollten, es sei dem, sie wären mit Exkommunikation oder Interdikt belegt ...
Urkunde von Papst Innozenz IV. vom 21. April 1198
Später wurde dieser Friedhof zu klein und man errichtete einen zweiten, jenseits des Ardusson. Zu erreichen war er nur über eine Brücke. Nach Charrier soll in der Nordwestecke des erweiterten Klosterareals der Garten le Roucy (in Erinnerung an die letzte Äbtissin) mit diesem Nonnenfriedhof gelegen haben. Lage und Existenz sind jedoch zweifelhaft. Nach Angaben der heutigen Besitzer handelte es sich um einen Obstgarten.
Der Gutshof
 Der zur Abtei gehörende Gutshof - la ferme oder la basse-cour genannt - liegt südlich derselben an der heutigen Departementstraße 442 von Troyes nach Nogent und ist als Ensemble heute noch sehr gut erhalten, da er von den Zerstörungen der französischen Revolution verschont geblieben ist. Bauteile aus Heloïsas Zeit wird man allerdings vergeblich suchen. Wenn man sich von der Straßenseite dem Paraklet nähert, fallen die für einen Gutshof ungewöhnlich hohen und fensterlosen Mauern und zwei markante, runde Ecktürme ins Auge. Der ganze Hof beschreibt - wie auf der Luftaufnahme gut zu erkennen ist - ein großes, unregelmäßiges Viereck. Die genaue Beschreibung der Gebäude kann bei Willocx nachgelesen werden (Albert Willocx, Abélard, Heloïse et le Paraclet, 1996).
Der zur Abtei gehörende Gutshof - la ferme oder la basse-cour genannt - liegt südlich derselben an der heutigen Departementstraße 442 von Troyes nach Nogent und ist als Ensemble heute noch sehr gut erhalten, da er von den Zerstörungen der französischen Revolution verschont geblieben ist. Bauteile aus Heloïsas Zeit wird man allerdings vergeblich suchen. Wenn man sich von der Straßenseite dem Paraklet nähert, fallen die für einen Gutshof ungewöhnlich hohen und fensterlosen Mauern und zwei markante, runde Ecktürme ins Auge. Der ganze Hof beschreibt - wie auf der Luftaufnahme gut zu erkennen ist - ein großes, unregelmäßiges Viereck. Die genaue Beschreibung der Gebäude kann bei Willocx nachgelesen werden (Albert Willocx, Abélard, Heloïse et le Paraclet, 1996).
 Der Kupferstich von 1770 (veröffentlich in: "La Vallée et Brion, Voyage dans les départements de la France. -Département de l'Aube", Paris 1793, Seite 20) gibt am rechten Bildrand auch Teile des Gutshofes wieder: Man erkennt hier einen der Rundtürme, der etwas höher erscheint als der heutige, dahinter ein lockeres Ensemble an Einzelgebäuden. Es existiert heute noch ein weiterer Turm derselben Bauart an der Nordwestecke des Hofes, ein dritter an der Südostecke machte dem Wohnhaus
der späteren Besitzer Platz.
Was gab einst den Grund, die landwirtschaftlichen Gebäude im Inneren derart zu bewehren?
Der Kupferstich von 1770 (veröffentlich in: "La Vallée et Brion, Voyage dans les départements de la France. -Département de l'Aube", Paris 1793, Seite 20) gibt am rechten Bildrand auch Teile des Gutshofes wieder: Man erkennt hier einen der Rundtürme, der etwas höher erscheint als der heutige, dahinter ein lockeres Ensemble an Einzelgebäuden. Es existiert heute noch ein weiterer Turm derselben Bauart an der Nordwestecke des Hofes, ein dritter an der Südostecke machte dem Wohnhaus
der späteren Besitzer Platz.
Was gab einst den Grund, die landwirtschaftlichen Gebäude im Inneren derart zu bewehren?
Gutshöfe waren in Kriegzeiten einer starken Gefahr der Plünderung und nachfolgenden Brandschatzung ausgesetzt. Nach Norden und Osten war das Kloster durch einen natürlichen Wasserlauf gesichert - das Flüsschen Ardusson. Nach Süden jedoch, wo das Land sanft-hügelig ansteigt, lag die Flanke des Hofes offen. Nur zweimal war das Paraklet-Kloster direkt in kriegerische Handlungen verwickelt:
- Während des Hundertjährigen Krieges verwüsteten - vermutlich um 1359 - die englischen Söldnertruppen von Eustache d'Aubercicourt das Paraklet-Kloster. Es ist überliefert, dass Henry de Poitiers die Engländer im Jahre 1359 in der denkwürdigen Schlacht von Nogent-sur-Seine dezimierte, wobei er Eustache d'Aubercicourt gefangen nehmen ließ. Aber noch im Jahre 1364 verfolgte er die Söldnerbanden, die auf ihren Raubzügen die Gegend ausplünderten. Es ist jedoch fraglich, ob sich zur damaligen Zeit das Kloster bereits mit Turm- und Mauerbewehrung schützen konnte; im übrigen ist überliefert, dass es bis auf die Grundmauern zerstört wurde.
- Unter der Äbtissin Jehanne de Chabot, der ehemaligen Priorin von Jouarre, deren Regiment 33 Jahre dauerte, erlebte der Paraclet eine der schlimmsten Perioden seiner langen Geschichte. Die neue Lehre des Protestantismus drang selbst in das Innere der Klöster und gewann dort Anhänger. Im Jahre 1567 fiel die protestantische Armee, geführt von Condé, Coligny und d'Andelot, in die Gegend ein, plünderte, massakrierte die Einwohner und brannte die Häuser nieder. Jehanne de Chabot lud die Leute der Nachbardörfer ein, sich ins Kloster mit ihren Herden und ihrem Hab und Gut zu flüchten. Um die Verteidigung zu organisieren, berief sie 200 bewaffnete Männer, die den Ansturm der Häretiker zurückschlagen sollten. Die auf obigem Kupferstich im Bereich des späteren Gutshofes zu erkennende Häuseransammlung beschreibt eventuell die Folge dieser überstürzten Umsiedelung. Zu diesem Zeitpunkt wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit die bereits seit 1509 bestehende Umfassungsmauer verstärkt und eventuell mit Ecktürmen bewehrt. Die heute nachweisbaren Türme stammen allerdings aus späterer Zeit; sie scheinen keiner militärischen Funktion gedient
zu haben. Inwieweit die Vorkehrungen wirklich Schutz boten, bleibt im Dunkel der Geschichte. Es handelte sich nicht um eine Verteidigungsanlage im üblichen Sinne, die einem christlichen Kloster aus prinzipiellen Gründen auch nicht entsprach. Es ist allerdings überliefert, dass 1576 ein Einfall der berüchtigten Deutschen Reiter, les reistres, die die angrenzenden Dörfer in Schutt und Asche legten,
verhindert werden konnte. Die couragierte Äbtissin verstärkte ihr Kloster - faire forcer sa maison
- stellte ein Freiwilligencorps von 200 Mann auf - tous bons soldatz et gens de coeur, pour mettre en garnison en sondit monastère
- und konnte so einen Einfall verhindern - lesdis reistres n'y entrerent point.
Später trat die Äbtissin mit einigen Nonnen - zum Schrecken des restlichen Konventes - dennoch zum reformierten Glauben über. Ihr Engagement auf Seiten der Protestanten gipfelte darin, dass sie deren höchste Würdenträger in ihr Kloster einlud und sich weigerte, an den Gottesdiensten der Benediktinermönche teilzunehmen. Trotz des Drängens der Mehrheit der Schwestern, sie solle abdanken, verweigerte sie dies standhaft, behielt ihren Titel und ihr Habit bis zu ihrem Tode im Jahre 1592. Sie hinterließ einen fast leeren Konvent, in dem nur noch drei Schwestern verblieben waren.
 Ein in der Nordostecke des Hofes stehendes, aus Bruchstein gemauertes, im Untergeschoss gewölbtes Gebäude, das mit seinem hohen Satteldach, seinen trutzigen Mauern und dem vorgemauerten Strebewerk einen frühmittelalterlichen Eindruck macht, trägt den Namen cellier aux moines, d.h. Keller für die Mönche. Es ist 20 m lang, 5 m breit und hat eine Geschosshöhe von 3 m.
Ein in der Nordostecke des Hofes stehendes, aus Bruchstein gemauertes, im Untergeschoss gewölbtes Gebäude, das mit seinem hohen Satteldach, seinen trutzigen Mauern und dem vorgemauerten Strebewerk einen frühmittelalterlichen Eindruck macht, trägt den Namen cellier aux moines, d.h. Keller für die Mönche. Es ist 20 m lang, 5 m breit und hat eine Geschosshöhe von 3 m.
Es besteht aus einem Untergeschoss mit Gewölbe und einem ungewölbten oberen Stockwerk. Das Untergeschoss besteht aus einem Schiff mit fünf Gewölbejochen, mit Kreuzgewölben und ganzen Gurtbögen, alle Öffnungen sind neuerer Bauart, abgesehen von einem kleinen Rundbogenfenster.
Arbois de Jubainville: Répertoire archéologique du département de l'Aube, Paris, 1861
 Dieses
Gebäude stammt jedoch nicht aus dem 12. Jahrhundert - wie von Arbois de Jubainville
einst
berichtet. Eine Überprüfung des Gebäudes durch G. Vilain hat ergeben, dass das Mauerwerk zum Teil
Einzelsteine mit Brandspuren, zum Teil nachträglich eingefügte Steinelemente
enthält. Diese müssen aus späterer Zeit stammen. Das Innengewölbe des Untergeschosses ist zu flach, um mit den Gewölben des 12. Jahrhunderts zu korrelieren. Die vorhandenen Gewölbe passen
aufgrund ihrer Ausführung vielmehr ins 17. oder 18. Jahrhundert. Außerdem berichtet ein Pachtvertrag vom
25. März 1780 von "einer Kornkammer über dem gewölbten Stall". Somit scheint das Gebäude trotz seines altertümlichen Aussehens recht eindeutig aus der Zeit zwischen 1614 und 1619 zu stammen, allerdings teilerrichtet aus älterer Bausubstanz. 1853 wurde es durch Baron Walckenaer nochmals modifiziert, um einem Bewässerungskanal Platz zu schaffen, der eine Turbine zum Betrieb einer
Dreschmaschine im Innern des Hofes versorgte.
Dieses
Gebäude stammt jedoch nicht aus dem 12. Jahrhundert - wie von Arbois de Jubainville
einst
berichtet. Eine Überprüfung des Gebäudes durch G. Vilain hat ergeben, dass das Mauerwerk zum Teil
Einzelsteine mit Brandspuren, zum Teil nachträglich eingefügte Steinelemente
enthält. Diese müssen aus späterer Zeit stammen. Das Innengewölbe des Untergeschosses ist zu flach, um mit den Gewölben des 12. Jahrhunderts zu korrelieren. Die vorhandenen Gewölbe passen
aufgrund ihrer Ausführung vielmehr ins 17. oder 18. Jahrhundert. Außerdem berichtet ein Pachtvertrag vom
25. März 1780 von "einer Kornkammer über dem gewölbten Stall". Somit scheint das Gebäude trotz seines altertümlichen Aussehens recht eindeutig aus der Zeit zwischen 1614 und 1619 zu stammen, allerdings teilerrichtet aus älterer Bausubstanz. 1853 wurde es durch Baron Walckenaer nochmals modifiziert, um einem Bewässerungskanal Platz zu schaffen, der eine Turbine zum Betrieb einer
Dreschmaschine im Innern des Hofes versorgte.
Exkurs: War Abaelards Vision eines Doppelklosters Wirklichkeit geworden?
Abaelard hatte sich hierzu in seinem Regelentwurf für die Nonnen des Paraklet festgelegt:
Das, was draußen zu erledigen ist, sollen die Brüder beschaffen, und die Schwestern sollen nur das tun, was im Innern des Klosters passenderweise von Frauen besorgt werden kann: den Brüdern Kleider anzufertigen oder zu waschen, Brotteig zuzubereiten, zum Backen zu übergeben und das Gebackene wieder in Empfang zu nehmen.
Abaelard, Brief 8, Regel für die Nonnen des Paraklet
Danach setzen wir uns in den Kreuzgang und lesen und beschäftigen uns. Hierauf machen wir uns an die Arbeit, zu welcher Tagesstunde wir auch notwendigerweise gerufen worden sind.
Institutiones Nostrae, PL Band 178
- Schon 1156 - also zu Lebzeiten Heloïsas - war in einer Bulle von Papst Hadrian IV. die Erlaubnis erteilt worden, die assoziierten fratres im Nonnenfriedhof zu begraben.
- Anfang 1198 ist in einer Bulle von der Ordination von capellani zur Abhaltung von Gottesdiensten die Rede.
- Im Jahre 1194 verlieh der Ortsbischof von Troyes der Äbtissin das Recht, einen der "Brüder des Paraklet" als Gemeindepfarrer in Quincey zu ernennen. Dieses Recht sollte bis zur französischen Revolution fortbestehen.
- Im Jahre 1202 wurden nach den Akten ein Kanoniker von Troyes angeklagt, die capellanos et conversos earum, d.h. die Kapläne und Laienbrüder der Nonnen, angegriffen zu haben.
- In einer Urkunde vom Januar 1239 ist ein gewisser Theobaldus de Donna Maria als presbiter, procurator et administrator bonorum ecclesie Paracliti, also Priester, Pfleger und Verwalter der Güter des Paraklet genannt, 1249 Petrus de Bordis aus Troyes als ballivus et custos bonorum Paracliti, d.h. als Verwalter und Wächter der Paraklet-Güter.
- In einer Urkunde von 1313 ist erstmalig auch von einem Kaplan
eines Tochterpriorates die Rede: capellanus domus Dei de Triangulo, d.h. Kaplan des Gotteshauses von Traînel.
(alle Textstellen aus Abbé Lalore, Cartulaire de l'abbaye du Paraclet, Paris, 1878).
- Später übernahmen patres die wirtschaftliche Gesamtleitung des Konventes, im Auftrag der Äbtissin: Im Jahre 1747 nannten sich zwei Dominikaner-Patres directeurs. Während der französischen Revolution hatten diesen Posten zwei Benediktiner von Villenauxe inne. Sie residierten zu diesem Zeitpunkt in der Abtei. (Roserot, Dictionnaire historique de la champagne méridionale, 1790).
- Das Totenbuch des Paraklet erwähnt ebenfalls an mehreren Stellen Begräbnisse von Brüdern, z.B. frater Jacobus, frater Petrus, confessores nostri.
- Das Totenbuch der Abtei Chelles bei Paris bestätigte die gemischte Personalausstattung des Paraklet-Konventes: commemoracio fratrum et sororum Sancti Paracliti.
- Außerdem trägt - wie erwähnt - der im Nordosten des Wirtschaftshofes gelegenen gewölbte Keller den bezeichnenden Namen cellier aux moines.
Doch soll bezüglich der Mönche die Einschränkung gelten, dass sie, entfernt vom Privatbereich der Nonnen, auch keinen Privatzutritt in den Vorraum des Klosters haben sollen... Auch alle Brüder sollen sich bei Ablegung ihres Gelübdes den Schwestern gegenüber eidlich verpflichten, dass sie sie in keiner Weise belästigen und für ihre leibliche Keuschheit nach Kräften eintreten werden.
Abaelard, Brief 8, Regel für die Nonnen des Paraklet
Ob Abaelards Wunsch eines gleichberechtigten Männerkonvents mit der Gesamtleitung eines Abtes Wirklichkeit wurde, ist jedoch mehr als fraglich:
Wir wollen aber, dass der Vorgesetzte der Mönche, den man Abt nennt, die Aufsicht über die Nonnen in der Weise führe, dass er in ihnen, die Gottes Bräute sind, dessen Diener er selbst ist, seine Herrinnen erblicke, über die nicht zu gebieten, sondern denen zu nützen ihn freuen soll...
Abaelard, Brief 8, Regel für die Nonnen des Paraklet
Der Ort, wo die in den Urkunden immer wieder erwähnten conversae, die Laienschwestern, die jedoch ebenfalls von den Chornonnen getrennt leben mussten, untergebracht waren, ist aus den heutigen Überresten der Anlage nicht eindeutig zu erschließen.
Am 16. November 1770 verpachtete die Äbtissin Charlotte de la Rochefoucauld den Gutshof dem Landwirt Michel Blaque und seiner Frau Jeanine Vergeot zur Bewirtschaftung. Er umfasste damals 180 Hektar bebaubares Land mit über 9 Hektar Wiesen. Das Kloster behielt sich lediglich 12 Hektar bebaubares Land, zwei Wiesen und die ganzen Wälder zurück. Der Hof enthielt damals auch die Weinpresse, den Cellier aux Moines mit dem Speicher darüber, den heute noch stehenden, ebenfalls frühmittelalterlichen Taubenturm im hinteren Bereich des Hofes, einen Stall mit Gewölbe und zwei kleine zugehörige Gebäude, Schuppen und Hühnerställe. Als Pachtzins lieferte der Bauer jedes Jahr den Schwestern 20 Wagenladungen guten Mistes für den Obst- und Gemüsegarten, versorgte die Nonnen mit 6 Fuhren Brennholz, lieferte ihnen 300 Scheffel Weizen, ebensoviel Roggen und zahlte ihnen die Summe von 24000 Silberpfund.
Nachdem dieser Hof als Nationalgut am 5. April 1791 an zwei Herren namens Lemerle und Audige verkauft worden war, wurde er am 12. März 1793 vom Trödler Pierre Simon für 60 900 Livres erworben - zusammen mit der Mühle, en un seul lot. Dieser überließ ihn im Dezember 1793 dem Notar von Nogent, Joseph Hayaux, welcher ihn wiederum im Juni 1794 an Antoine Bézuchet verkaufte. Dieser ließ jedoch den Kauf annullieren, weil er sich durch eine starke Entwertung des Papiergeldes betrogen fühlte. Der Bauernhof fiel also auf Pierre Simon zurück.
Bei dessen Tod wurde er versteigert und dem Ehepaar Beauvallet im Mai 1805 zugesprochen. Der Baron Charles-Athanase-Marie Walckenaer erwarb ihn schließlich vom Ehepaar Beauvallet am 26. Mai 1830 für die Summe von 96000 Franc und brachte ihn in der Folge wieder wirtschaftlich in die Höhe - allerdings um einen hohen Preis, was die Situation des ehemaligen Klosters anbetraf. (nach Albert Willocx, Abélard, Heloïse et le Paraclet, 1996)
Die Wirtschaftsgebäude hinter dem Konvent
Den Schwestern obliegt auch die Milchwirtschaft sowie die Hühner- und Gänsezucht, überhaupt alles, was passender Frauen als Männer verrichten können.
Abaelard, Brief 8, Regel für die Nonnen des Paraklet
 Den
Nonnen war der Zutritt zum Gutshof verwehrt. So benötigten sie für die ihnen zustehenden land- und hauswirtschaftlichen Arbeiten weitere Gebäude wie Küche, Wäscherei, Käserei, Schlachthaus. In einem Kloster waren auch Werkstätten erforderlich, die Wasser oder Befeuerung erforderten, z.B. Schmiede, Mühle, Bäckerei. Aus Brandschutzgründen mussten sie von den Scheunen und Speichern des
Gutshofes entfernt sein. Auch Funkenflug durfte nicht zur Gefahr werden.
Den
Nonnen war der Zutritt zum Gutshof verwehrt. So benötigten sie für die ihnen zustehenden land- und hauswirtschaftlichen Arbeiten weitere Gebäude wie Küche, Wäscherei, Käserei, Schlachthaus. In einem Kloster waren auch Werkstätten erforderlich, die Wasser oder Befeuerung erforderten, z.B. Schmiede, Mühle, Bäckerei. Aus Brandschutzgründen mussten sie von den Scheunen und Speichern des
Gutshofes entfernt sein. Auch Funkenflug durfte nicht zur Gefahr werden.  Ein Teil dieser Werkstätten lagen im Bereich des heutigen Mühlgebäudes, ein anderer Teil im Nordosten des Klostergeländes, unmittelbar am Ardusson hinter den Konventgebäuden, möglicherweise im Bereich des ehemaligen Nonnenfriedhofs und
des Oratoriums petit moustier. Zumindest bekommt man diesen Eindruck durch die Betrachtung
des bekannten Kupferstichs. Die Gebäude standen z. T. unter der unmittelbaren Aufsicht der Nonnen - ganz im Sinne Abaelards.
Die Geflügelzucht und der Klostergarten lagen eher im nördlichen Abschnitt des Klosterareals. Der heute noch stehende Geflügelhof östlich des Gutshofes und der südlich sich anschließende, kreuzförmig mit Buchsbaumhecken durchzogene Garten stammen aus dem vorigen Jahrhundert. Sie wurden mit einem eigens von Walckenaer angelegten Wasserzulauf versorgt und haben mit der mittelalterlichen Geflügelzucht nichts mehr gemein. Hier existiert noch ein Brunnen, dessen Einfassung aus dem 13. Jahrhundert stammen soll, und der einst zum Konventsgebäude gehörte:
Ein Teil dieser Werkstätten lagen im Bereich des heutigen Mühlgebäudes, ein anderer Teil im Nordosten des Klostergeländes, unmittelbar am Ardusson hinter den Konventgebäuden, möglicherweise im Bereich des ehemaligen Nonnenfriedhofs und
des Oratoriums petit moustier. Zumindest bekommt man diesen Eindruck durch die Betrachtung
des bekannten Kupferstichs. Die Gebäude standen z. T. unter der unmittelbaren Aufsicht der Nonnen - ganz im Sinne Abaelards.
Die Geflügelzucht und der Klostergarten lagen eher im nördlichen Abschnitt des Klosterareals. Der heute noch stehende Geflügelhof östlich des Gutshofes und der südlich sich anschließende, kreuzförmig mit Buchsbaumhecken durchzogene Garten stammen aus dem vorigen Jahrhundert. Sie wurden mit einem eigens von Walckenaer angelegten Wasserzulauf versorgt und haben mit der mittelalterlichen Geflügelzucht nichts mehr gemein. Hier existiert noch ein Brunnen, dessen Einfassung aus dem 13. Jahrhundert stammen soll, und der einst zum Konventsgebäude gehörte:
In der Nähe findet sich ein Steinbrunnen, innen rund, außen oktogonal, geschmückt mit einem Froschkopf, aus dem 13. Jahrhundert...
Arbois de Jubainville, Répertoire archéologique du Département de l'Aube Paris, 1861
 In der Revolutionszeit wurden die Sakralbauten des Klosters gründlich zerstört - nicht jedoch die Gebäude, von denen man glaubte, sie noch einer wirtschaftlichen Nutzung zuführen zu können. Ein kleines Stahlwerk, wo man Feilen und Ackerbaugerät herstellte, wurde in den noch stehenden Mühlgebäuden am Ardusson eingerichtet. Nach wirtschaftlicher Nutzung durch die Sozietät Weyer und Cie ging es mit dem Stahlwerk allmählich bergab, bis es solche Verluste einfuhr, dass es Konkurs anmelden musste. General Pajol kaufte schließlich auch dieses Werk mit seinen Nebengebäuden im Jahr 1830. Wann die Gebäude endgültig abgetragen wurden, ist ungewiss.
In der Revolutionszeit wurden die Sakralbauten des Klosters gründlich zerstört - nicht jedoch die Gebäude, von denen man glaubte, sie noch einer wirtschaftlichen Nutzung zuführen zu können. Ein kleines Stahlwerk, wo man Feilen und Ackerbaugerät herstellte, wurde in den noch stehenden Mühlgebäuden am Ardusson eingerichtet. Nach wirtschaftlicher Nutzung durch die Sozietät Weyer und Cie ging es mit dem Stahlwerk allmählich bergab, bis es solche Verluste einfuhr, dass es Konkurs anmelden musste. General Pajol kaufte schließlich auch dieses Werk mit seinen Nebengebäuden im Jahr 1830. Wann die Gebäude endgültig abgetragen wurden, ist ungewiss.
Der Platz des Paraclet war kürzlich von einem Werk eingenommen worden, wo man im Jahre 1822 eine Fabrik für Feilen und Stahlgerät eingerichtet hatte, die heute außer Betrieb ist, sehr zum Bedauern der umliegenden Gemeinden, denen sie Beschäftigung gewährte.
Guide pittoresque du voyageur en France, Paris, 1838
Ich ging zum "Tourne-bride", wo die Pferde abgesattelt worden waren, hinüber, um mein Mittagessen einzunehmen, da teilte mir die Gastwirtin mit, dass Frau Äbtissin den Befehl gegeben habe, mich unverzüglich nach meiner Ankunft in den Konvent zu führen, weil ich dort mit ihr speisen sollte, und dass ich schon erwartet würde...
Lacoine, Brief an Baron Walckenaer, zitiert nach Albert Willocx, Abélard, Heloïse et le Paraclet, 1996
Die Veränderung des Paraklet-Areals durch Baron Walckenaer
Er war im 19. Jahrhundert der erste, der die brachliegende Landwirtschaft wieder auf Vordermann brachte. Dazu war umfangreicher Landschaftsbau erforderlich: Er reduzierte die Weizenanbaufläche, beseitigte viel Brachland am Ardusson und legte neue Weideflächen an, vermehrte so den Bestand seiner Herde und verlegte sich auf Tiermast. Zu einem effektiven Mühlbetrieb musste er - wie schon erwähnt - den gesamten kanalisierten Oberlauf des Ardusson verlängern. Er ließ zum Schutz vor Überschwemmungen höhere Deiche errichten. Stromabwärts ließ er ein vertieftes Flussbett graben und brachte so das Wassergefälle der neuen Mühle auf 2,80 m, so dass er mit einem Wasserrad von 5,60 m Durchmesser 12 Pferdestärken erzeugen konnte.
 Er verwandelte das Gelände a quodam loco humido et aquoso, d.h. von einem feuchten und wasserreichen Ort, (Protokoll von 1497) in ein fruchtbares und trockenes Weideland. Mit dem Aushubmaterial ließ er wahrscheinlich das Gelände zwischen neuem Bachlauf und dem Gutshof - einschließlich des Abtei-Areals - aufschütten und trockenlegen. Zur Wasserversorgung des Hofes errichtete er einen ebenfalls vom Oberlauf des Ardusson abgezweigten Kanal von 500 Metern, der im Hof die Viehtränke und Dreschmaschine versorgte. Insgesamt ließ er so mehr als 16 km Drainagegräben anlegen und legte den Park, die Wiesen und mehrere Flächen Sumpfland trocken, welches er z. T. mit Bäumen bepflanzte. Die im Bild links rosa unterlegten Flächen entsprechen diesen Landschaftsveränderungen durch Baron Charles Walckenaer.
Er verwandelte das Gelände a quodam loco humido et aquoso, d.h. von einem feuchten und wasserreichen Ort, (Protokoll von 1497) in ein fruchtbares und trockenes Weideland. Mit dem Aushubmaterial ließ er wahrscheinlich das Gelände zwischen neuem Bachlauf und dem Gutshof - einschließlich des Abtei-Areals - aufschütten und trockenlegen. Zur Wasserversorgung des Hofes errichtete er einen ebenfalls vom Oberlauf des Ardusson abgezweigten Kanal von 500 Metern, der im Hof die Viehtränke und Dreschmaschine versorgte. Insgesamt ließ er so mehr als 16 km Drainagegräben anlegen und legte den Park, die Wiesen und mehrere Flächen Sumpfland trocken, welches er z. T. mit Bäumen bepflanzte. Die im Bild links rosa unterlegten Flächen entsprechen diesen Landschaftsveränderungen durch Baron Charles Walckenaer.
Die Alten des Landes haben es mir oft wiederholt, dass gegen die Stunde, zu der die Schwestern einst die Morgengesänge sangen, man immer noch das Seufzen in den Ruinen hören kann... Ich berichte Gott mit einem Herzen, welches meiner siegreichen Arbeit größer werdenden Erfolg erkennt, und die Ehre, die ich erhalte als Tätiger in der Plage und ich spreche zu mir mit freier Stimme: Diese Maschinen, diesen Park, dieses Brachland da drüben, mit der Hilfe Gottes hast du das alles geschaffen.
verkündete Charles Walckenaer nicht ohne Pathos in seinen Schriften (zitiert aus Albert Willocx, Abélard, Heloïse et le Paraclet, 1996).
- Große Teile des Klostertopographie wurden bis zur Unkenntlichkeit verändert. Als Besucher kann man sich aus der Bodenperspektive kaum mehr ein Bild des ursprünglichen Terrains verschaffen. Vor allem wegen dieser weitreichenden Veränderungen haben sich Willocx und Charrier in mancher Aussage geirrt. Durch die Auswertung der Kupferstiche und der Luftaufnahmen konnten die vormaligen Landmarken z. T. noch sichtbar gemacht, und die baulichen Gegebenheiten verdeutlicht werden.
- Andererseits hat Baron Walckenaer mit seinen Aufschüttungsmaßnahmen das Klosterareal, mit den vermutlich noch erhaltenen Fundamenten und zahlreichen Trümmern durch eine Humusschicht für spätere Zeiten konserviert.
Das Paraklet-Klosters nach 1686 - Kupferstich um 1770
veröffentlich in: "La Vallée et Brion, Voyage dans les départements de la France. -Département de l'Aube", Paris 1793, Seite 20

Hypothetischer Grundriss um 1700

Bitte mit der Maus über die Karte fahren!
Abteigebäude nach dem Katasterplan von 1809 (Fundamente) - - - Ardusson-Kanal - - - Ardusson um 1700 - - - Gebäude um 1700
Resümee
- Das Paraklet-Areal war von Abaelard sorgfältig ausgewählt worden, zunächst für die Errichtung einer Einsiedelei, jedoch mit dem letztendlichen Ziel der Errichtung einer Klostergemeinschaft.
- Der Paraklet wurde in der Tat in einer Einöde errichtet, abseits des alten Handelsweges.
- Es entwickelte sich hier die erste freie, nicht primär an ein Domkapitel oder einen Konvent gebundene, wissenschaftliche Schule Europas. Der Paraklet ist somit der Gründungsort der ersten freien Universität. Der Begriff des universitären campus findet hier seine Ursprung und seine augenscheinliche Entsprechung.
- Das Paraklet-Areal wies im 12. Jahrhundert alle notwendigen Voraussetzungen für die Gründung eines Reformklosters auf.
- Seiner eigentlichen Zweckbestimmung als Kloster wurde der Paraklet erst durch die Übertragung an Heloïsa und ihre Nonnengemeinschaft nach 1129 zugeführt.
- Der hier entstehende Frauenkonvent zeigte alsbaldige Prosperität und nachfolgend erstaunliche Vitalität über fast 700 Jahre.
- Ein Kupferstich des Paraklet-Klosters zeigt detailgetreu den Anblick der Klosteranlage nach 1686, ein zweiter das Aussehen der Abtei um 1790, also kurz vor der Zerstörung, ein dritter die rückwärtige Ansicht der teilzerstörten Klostergebäude.
- Durch die Zerstörungen der französischen Revolution und den nachfolgenden Landschaftsbau hat sich das Anwesen an vielen Stellen bis zur Unkenntlichkeit verändert.
- Zusätzliche und zum Teil neue Aspekte zur Beurteilung der Topographie ergeben sich aus Details einer aktuellen Luftbildaufnahme von 1998.
- Durch diese Darstellungen und Auswertung der Quellen sind Kenntnisse zur Architektur und Baugeschichte des Paraklet und eine Rekonstruktion der vormaligen Klosteranlagen in den Grundzügen möglich.
- Bereits im 12. Jahrhundert - zu Lebzeiten der Gründer - wurde der Grundriss des Klosters, die exakte Ausrichtung nach Osten und die prinzipielle Verteilung der Gebäude festgelegt. Auch spätere Erweiterungen und Umbauten lösten dieses ursprüngliche Konzept nicht auf.
- Das Kloster belegte mit seinen Gebäuden ein relativ umgrenztes Areal am linken Ufer des Ardusson. Die Gründungsanlage Abaelards war darin integriert und hat bis zur französischen Revolution existiert.
- Insgesamt gab es zwei Kultstätten im Bereich des Paraklet: Die Kapelle le petit moustier lag östlich des Chores der Abteikirche. Sie bezeichnete wohl Abaelards erstes Oratorium und die erste Begräbnisstätte des Gründerpaares.
- Vermutlich wurde schon zu Lebzeiten Heloïsas, spätestens jedoch nach der Zerstörung der Abtei im Hundertjährigen Krieg, eine Kapelle der Heiligen Dreifaltigkeit in den Chorraum der Abteikirche integriert. Sie enthielt zuletzt den Hauptaltar, auch die Trinitätsstatue und die letzte Grabstätte von Abaelard und Heloïsa.
- Die Erkenntnisse legen nahe, dass der Paraklet-Konvent in allen Phasen seines Bestehens in besonderer Weise seinen beiden berühmten Gründern Rechnung trug und ihre Verehrung pflegte.
- Aus den gewonnenen Erkenntnissen heraus wurde ein hypothetischer Grundriss des Paraklet-Klosters zur Zeit des späten 17. Jahrhunderts formuliert. Eine Verifizierung ist naturgemäß nur durch Sichtung weiterer Quellen oder eine archäologische Exploration und exakte Vermessung möglich.
- Vermutlich sind ein Teil der Fundamente, eventuell auch weitere Teile der Klosteranlage, unter der im 19. Jahrhundert erfolgten Aufschüttung des Terrains noch erhalten und wären prinzipiell einer weiteren Untersuchung und Teilrekonstruktion zugänglich.
Ausblick
 |
Aspiciebam in visu noctis et ecce... Ich erblickte in einem Traumbild der Nacht - und siehe... Abaelard, Dialogus inter Philosophum, Iudaeum et Christianum |
Der Paraklet ist der Urboden der europäischen Universität, steinernes Zeugnis für die ungewöhnliche Beziehung zweier berühmter Menschen des Frühmittelalters, ein Symbol für eine Gott und den Menschen gleichermaßen zugewandte, tolerante Theologie. Deswegen hätte er es verdient, mehr beachtet zu werden. Eine Bestandserhaltung wird durch die heutigen Besitzer mit staatlicher Unterstützung nach Kräften versucht. Auch ist das Areal - zumindest in den Sommermonaten - für eine Besichtigung geöffnet. Für eine Teilrekonstruktion der Klosteranlage oder eine Exploration der ersten Grablege des Gründerpaares fehlen aber offensichtlich Mittel und Initiative. Noch immer liegt der Paraklet unverbaut und fernab der Städte in reizvoller Umgebung, in einem herrlichen Park. Alle Abaelard-Freunde sind hiermit aufgefordert, das ihre zu tun, um dieses wunderbare Stück Kulturgut im Herzen Frankreichs zu erhalten und nicht dem endgültigen Vergessen preiszugeben. Peter Abaelard und Heloïsa hatten sich einst gewünscht, hier - und nur hier - in Frieden gemeinsam zu ruhen. Dieser Wunsch ist bis heute nicht in Erfüllung gegangen: Abaelard wurde insgesamt neunmal, Heloïsa achtmal in ihrer Grabesruhe gestört. Seit 1814 ruhen ihre sterblichen Überreste im Friedhof PèreLachaise in Paris. Wegen ihrer geistigen Größe, ihrer zeitgeschichtlichen Bedeutung, ihrer einmaligen spirituellen Beziehung hätten sie es verdient, erneut und endgültig dorthin überführt zu werden, wo allein sie sich auch im Tode glücklich wähnten: in den Paraklet.
Verwendete Quellen